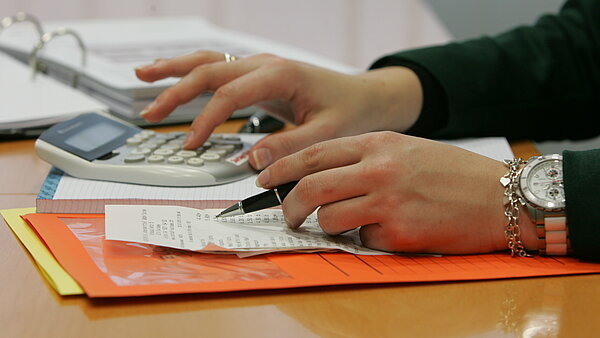Dieter Geissbühler, aus Metropolen sind Hochhäuser längst nicht mehr wegzudenken. Seit einiger Zeit schiessen sie auch in der Zentralschweiz aus dem Boden. Welche Rolle spielen sie in der Stadt der Zukunft?
Die Euphorie rund um das Hochhaus wird sich in der Schweiz wieder legen. Hochhäuser generieren eine hohe Dichte, das hat Konsequenzen. Wenn Grün- und Freiräume fehlen, besteht die Gefahr, dass die Dichte zur Belastung wird. Vielfach sind Hochhäuser vor allem Teil des Standortmarketings, die entsprechende Dichte könnte auch mit anderen Bebauungsarten erreicht werden.
Was spricht dafür, mit Hochhäusern verdichtet zu bauen?
Im Kern dreht sich alles um den Standort. Punktuell gibt es Orte, wo es Sinn macht, mit hoher Dichte zu bauen. Zum Beispiel auf dem Areal des künftigen Tiefbahnhofs in Luzern oder auf der Allmend beim Fussballstadion. Auch in Sursee machen Hochhäuser in Bahnhofnähe Sinn. Ob Hochhäuser aber generell dem Charakter der Schweizer Siedlungskultur entsprechen, ist fraglich.
Wird sich in der Schweiz je eine Hochhaus-Kultur etablieren können?
Möglicherweise eine bescheidene. 500-Meter-Hochhäuser gehören kaum zu unserer Mentalität.
Was macht ein Hochhaus mit unserer Wohnkultur?
Das Wohnen ist ein schwieriger Aspekt des Hochhauses. Von Natur aus befördert es die Anonymisierung der Bewohner. Jeder wohnt auf einem anderen Stock, man trifft sich nur im Lift oder in der Tiefgarage. Es braucht deshalb zusätzliche Räume und Massnahmen, damit die Wohngemeinschaft erlebt werden kann. Diese fehlen leider oft.
Wie nachhaltig ist der Bau von Hochhäusern? Schliesslich ist er sehr teuer und aufwendig.
Je höher wir bauen, desto tiefer müssen wir in den Boden. Das verschlingt Zeit und Geld. Interessanterweise spielen die Kosten für die Investoren, oft finanzkräftige Pensionskassen, gar keine Rolle mehr. Es gibt aber interessante, durchaus nachhaltige Ansätze im Bereich des Holz-Beton-Verbunds. Diese Ansätze kommen in der Schweiz erst zaghaft zur Anwendung.
2013 hat die Schweiz das Raumplanungsgesetz angenommen und damit dem verdichteten Bauen grünes Licht gegeben. Trotzdem sind die Vorbehalte gegenüber dem Verdichten gross. Weshalb dieser Gegensatz?
Niemand mag es, wenn seine Aussicht und sein Platz eingeschränkt werden. Dabei vergessen wir, dass die Dichte einer Stadt auch eine Qualität mit sich bringt: Es entsteht ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Austausch, das Zusammenleben blüht auf. Bis wir diese Qualität selber erleben, haben wir den Eindruck, durch das Verdichten eingeschränkt zu sein.
Gibt es denn überhaupt Alternativen zum verdichteten Bauen in die Höhe?
Generell kommen wir ums dichte Bauen nicht herum, wenn wir die Landschaft nicht noch stärker in Mitleidenschaft ziehen wollen. Neben dem Bauen mit punktuell hoher Dichte besteht die Möglichkeit, in ganzen Quartieren einfach moderat zu verdichten, zum Beispiel in Einfamilienhausquartieren. Allerdings ist hier der Widerstand der Bewohner oft gross. Ein wichtiger Lösungsansatz besteht im Verringern des eigenen Wohnbedarfs. Wieso muss eine 3,5-Zimmer-Wohnung 100 Quadratmeter gross sein? So gibt es bereits Genossenschaften, die Modelle mit einem maximalen Quadratmeteranspruch pro Bewohner anwenden.
Eine Kernforderung des suffizienten Bauens.
Genau. Wir müssen uns fragen, auf was wir verzichten können beim Bauen, ohne das Gefühl zu haben, dass etwas verloren geht. Suffizienz (Anm.: Genügsamkeit) basiert stark auf dem Grundsatz der kompakten Kreisläufe – egal ob bei den Ressourcen oder der Mobilität.
Bitte erklären Sie.
Ein Beispiel ist die «Stadt der Viertelstunde», in der die wichtigsten Infrastrukturen – Läden, öV, Grünräume – in einer Viertelstunde erreichbar sind. Durch die kurzen Wege reduziert sich zwar nicht das Raumbedürfnis, aber die Mobilität. Auch durch Homeoffice werden Mobilitätskreisläufe kompakt gehalten.
Wie planen wir zukunftsfähige Städte und Siedlungen?
Weiterbauen! Städte sind hochkomplexe Organismen, an denen wir über Jahrhunderte hinweg gebaut haben. So haben sich alle europäischen Städte entwickelt, auch jene mit hoher Lebensqualität. Das Problem ist, dass heute zum Teil zu grosse Eingriffe vorgenommen werden. Klar braucht es Experimente wie zum Beispiel die Smart Citys. Diese haben aber die Tendenz, perfekte, durchgetaktete Maschinen sein zu wollen. Dabei hat die Vergangenheit klar gezeigt, dass die erfolgreichen Stadtmodelle die flexiblen sind, die sich laufend anpassen und verändern.
Braucht es dazu ein neues Verständnis davon, was gute Baukultur ist?
Ja, dabei sollten wir uns ein Beispiel an der Vergangenheit nehmen, ohne nostalgisch zu werden. Dazu gehört auch der Umgang mit der natürlichen Topografie. Heute ist es Usus, dass jeder einen planierten Vorgarten für seinen Gartentisch und seine Fussball spielenden Kinder hat. Hier müssen wir uns fragen, ob es das überhaupt braucht.