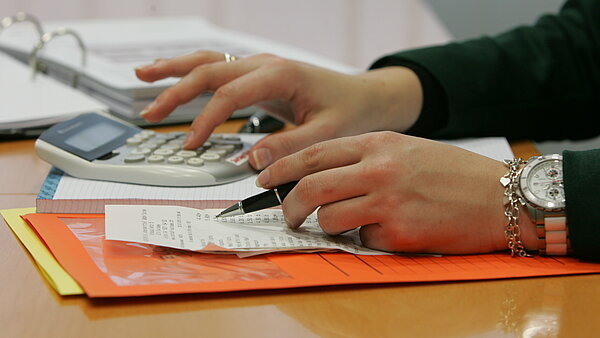Luzern ist ein Kanton mit vielen Landwirtschaftsbetrieben, die auf Tierproduktion setzen. Das ist hinlänglich bekannt und die Folge davon auch. Wo viele Tiere gehalten werden, fällt viel Gülle an. Aus dieser Quelle stammt einerseits der Phosphor, welcher das Ökosystem Sempachersee schon seit vielen Jahren belastet. Kanton und Gemeinden unternehmen seit Mitte der 80er-Jahre einiges, um den See gesunden zu lassen. Es sind dies die Seebelüftung und die Reduktion von Phosphoreinträgen (Ausgabe vom 30. Januar). Andererseits entweicht der Gülle auch Stickstoff, namentlich Ammoniak, der in die Luft emittiert und dann wieder an die Vegetation abgegeben wird. Die Luftschadstoffe aus den Tierexkrementen überdüngen und gefährden sensible Ökosysteme wie Wälder, Moore und Trockenwiesen. Dadurch wird auch die Artenvielfalt beeinträchtigt. Darüber hinaus tragen Treibhausgase aus der Landwirtschaft, beispielsweise Methan und Lachgas, zur Klimaveränderung bei.
Spitzenreiter in Sachen Tierdichte
Rund 93 Prozent der Amoniakemmission in der Schweiz stammen aus der Landwirtschaft, überwiegend aus der Tierhaltung, konkret durch das Ausbringen der Gülle und durch eiweisshaltiges Futter. Im Kanton Luzern beträgt die Tierdichte über 2,1 Grossvieheinheiten (GVE) pro Hektare. Somit liegt man zusammen mit dem Thurgau in Sachen Konzentration von Ammoniak an der Spitze. Wie aus dem Teilplan Ammoniak des Kantons Luzern hervorgeht, weist derKanton Luzern schweizweit die höchste Tierdichte auf, und die Tierdichte steigt tendenziell weiter an.
Der gesamtschweizerische Schnitt der GVE pro ha liegt bei 1,3 Einheiten. Klar ist, dass der Kanton und mit ihm die Region Sempachersee ein Hotspot der Ammoniakproblematik ist. «Der typische Luzerner Wald im Mittelland erhält alleine durch Ammoniak einen Eintrag von 35 bis 55 Kilogramm Stickstoff pro Hektare im Jahr», führt Markus Bucheli, Fachexperte Ammoniak des Kantons Luzern, aus. Hinzu kämen weitere Stickstoffverbindungen, die durch Niederschlag in die Natur gelangten, in der Grössenordnung von 20 Kilogramm Stickstoff pro Hektare. «Die langfristige Stabilität von Wäldern wäre jedoch mit Einträgen von insgesamt höchstens 20 Kilogramm N/ha gewährleistet.»
Hochtrabende Ziele
Diese Aussage verdeutlicht, wie gross die Herausforderung im Kanton Luzern ist, der Stickstoffbelastung Herr zu werden. Dazu hat der Regierungsrat im Jahr 2007 den Teilplan Ammoniak verabschiedet. Er hatte zum Ziel, bis 2010 die Emissionen zu stabilisieren und bis 2030 dann um 30 Prozent zu senken. Der Bundesrat hat im Bericht «Konzept betreffend lufthygienische Massnahmen des Bundes» von 2009 als Ziel für Ammoniak eineEmissionsreduktion
um rund 40 Prozent gegenüber 2005 festgelegt. Bund und Kantone fördern verschiedene Massnahmen in der Landwirtschaft mit finanziellen Beiträgen, namentlich eine schonendere Ausbringung und bessere Lagerung der Gülle sowie bauliche Massnahmen in Ställen wie Harnrinnen. Zudem sollte Hofdünger nur während den Zeiten des Pflanzenwachstums auf die Böden ausgebracht werden.
Stickstoff soll vor Ort bleiben
«Bei unsachgemässer Lagerung und Ausbringung der Gülle geht bis zu 70 Prozent des in ihm enthaltenen Stickstoffs in die Luft verloren», macht Markus Bucheli die Wichtigkeit der umrissenen Massnahmen deutlich. Es liege auch im Interesse der Landwirtschaft, dass der Stickstoff den landwirtschaftlichen Kulturen zugutekomme, was beispielsweise dank des Schleppschlaucheinsatzes besser gelinge. «Auch abgedeckte Güllelager verhindern, dass der Stickstoff als Ammoniak verloren geht.» Gegenüber 2007 hätten so die Amoniakemmissionen um gegen fünf Prozent reduziert werden können, ergänzt Markus Bucheli.
Nachhaltige Reduktion verfehlt
Doch: Messungen für 2018 und 2019 haben wieder höhere Konzentrationen zutage gefördert. Peter Bucher, Teamleiter Luftreinhaltung der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe): «Diese Zunahme ist vermutlich stark witterungsbedingt», blickt er auf zwei ausgesprochen warme Jahre zurück. Zum anderen hätten die Tierzahlen erneut leicht zugenommen. Peter Bucher räumt unumwunden ein: «Die gesetzten Ziele sind verfehlt worden.» Mit ein Grund ist eine tierfreundlichere Haltung, was auf den ersten Blick erstaunen mag. Eine stärkere Reduktion werde durch die Umbauten von Anbindeställen zu Laufställen beim Rindvieh verhindert. «Hier besteht ein Zielkonflikt zwischen dem Tierwohl und geringeren Ammoniakemissionen.»
Strengere Massnahmen folgen
Der Kanton will deshalb weiter beim Ammoniak ansetzen. «Eine Weiterentwicklung des Massnahmenplans Ammoniak mit zusätzlichen, strengeren Massnahmen ist in Ausarbeitung.» Er werde bald in Kraft gesetzt. Detaillierte Angaben folgten zu gegebener Zeit. Eine Reduktion von Ammoniak in der vom Bund angedachten Grössenordnung «ist in kurzer Zeit aus wirtschaftlichen und technologischen Gründen für die Luzerner Landwirtschaft nicht zumutbar», macht Markus Bucheli jedoch deutlich. «Er könnte in diesem Umfang nur durch drastisch tiefere Tierzahlen erreicht werden. Dies würde viele bäuerliche Existenzen bedrohen.»
Im See ist Phosphor massgebend
Sempachersee Stickstoff gelangt auch in den Sempachersee. Dort spielt er aber eine untergeordnete Rolle. «Das Wachstum der Algen wird bestimmt durch Phosphor, das für das Wachstum limitierende Element», führt Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer und Boden (uwe), aus. Somit ist die Konzentration an Phosphor für das Gedeihen der Algen bestimmend. «Er ist das knappste Element im See.» Stickstoff im Wasser könne von den Pflanzen somit nur soweit genutzt werden, bis der Phosphor aufgebraucht ist.