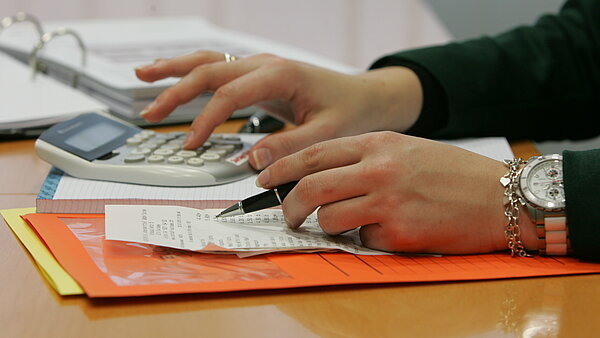Nottwil wird in der übrigen Schweiz schnell mit dem Schweizer Paraplegikerzentrum und mit der schönen Lage am Sempachersee in Verbindung gebracht. Diese zwei Faktoren haben massgeblich dazu beigetragen, dass der Ort gut ans Verkehrsnetz angeschlossen ist und eine hohe Nachfrage nach Bauland und Wohnungen besteht. «Wir könnten in den nächsten Jahren gut um weitere 1000 Einwohner wachsen», sagt Gemeindepräsident Walter Steffen. Warum man dies aber nicht will, warum er und Gemeinderatskollege Marcel Morf gerne in Nottwil leben und welche Identität sie der Gemeinde zuschreiben und wo sie ihre Zukunft sehen, erläutern sie im Doppelinterview.
Seit Jahren leben und wirken Sie in der Gemeinde Nottwil. Warum ist dies die Gemeinde ihrer Wahl?
Walter Steffen: Nottwil ist eine attraktive Gemeinde mit einem breiten Angebot. Dazu zählen der Bildungsbereich, das Leben im Alter,die Vereine und das reichhaltige Kulturangebot. Ich fühle mich sehr wohl hier.
Marcel Morf: Nottwil darf sich auch sehen lassen durch die gute Erschliessung, gerade im Bereich des öffentlichen Verkehrs mit zwei Buslinien und dem Zug, und die Nähe zu Zentren wie Luzern, Bern oder Basel. Ein weiterer Pluspunkt ist die Lage am See mit dem Blick zu den Bergen.
Was ist Ihre Motivation, so lange im Gemeinderat tätig zu sein?
Morf: Dank dieser Tätigkeit kann ich das Dorf mitgestalten. Auch wenn man es nicht jedem recht machen kann, habe ich in den vergangenen Jahren immer gespürt, dass die Bevölkerung hinter dem Gemeinderat steht und die Entscheide immer grossmehrheitlich mitgetragen hat.
Steffen: Als Gemeinderat hat man viele Möglichkeiten, eine Gemeinde zu prägen und weiterzubringen. Ich finde es eine grosse Bereicherung, wenn ich ein Projekt anreissen und mit der Zustimmung der Stimmberechtigten umsetzen kann.
Gibt es nicht viele Vorgaben, die den Spielraum einer Gemeinde-Exekutive einschränken?
Steffen: Es ist schon so, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Ausgaben gebunden ist, doch es gibt genügend Spielraum. In Nottwil herrscht eine Kultur des Machens. Das soll unser Ansporn sein, ansonsten wären wir bloss Verwalter, was unbefriedigend wäre.
Morf: Im Baubereich existieren etliche Vorschriften. Gleichwohl kann ein Gemeinderat zusammen mit der Bevölkerung festlegen, wie er die Gemeinde entwickeln und weiterbringen will, was sich gerade auch bei der anstehenden Ortsplanungsrevision wieder zeigen wird.
Wie hat sich das Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Gemeinderat entwickelt, seit Sie im Gemeinderat sitzen?
Morf: Ich erachte die Zusammenarbeit weiterhin als gut und respektvoll. Man hat aber schon gespürt, dass durch das Wachstum viele Neuzuzüger gekommen sind, was aber durchaus viele positive Aspekte hat. Nottwil ist schon längst nicht mehr ein «Bauerndörfli» wie noch vor 30, 40 Jahren.
Steffen: Die Bürger sind sicher anspruchsvoller geworden und tragen ihre Anliegen und Wünsche verstärkt an den Gemeinderat heran. Diesen Austausch erachte ich jedoch als positiv und zielführend, solange er respektvoll verläuft.
Besteht in Nottwil mit der heutigen Grösse eher mehr Distanz zu den Bürgern?
Steffen: Ich würde sagen, die Bürger kommen vielleicht etwas weniger zu uns. Dafür suchen wir aber aktiv die Nähe, beispielsweise durch Quartierbesuche des Gemeinderats in corpore zweimal im Jahr. Diese Gespräche finden in lockerer Atmosphäre statt. Man erfährt niederschwellig, was die Nottwilerinnen und Nottwiler bewegt.
Morf: Auf diese Weise kann man auch Leute kennenlernen, die neu in Nottwil wohnen. Die wertvollen Inputs aus der Bevölkerung nehmen wir mit in unsere Arbeit im Gemeinderat. Man kann durchaus sagen, dass dieser Umstand auch den Horizont erweitert.
Steffen: Weiter gelingt es uns auch, die Menschen für Projekte zu sensibilisieren und ihnen unsere Beweggründe zu erläutern. Man kann vertieft diskutieren, der Aufwand lohnt sich.
Wie beurteilen Sie die Einwohnerzufriedenheit?
Steffen: 2016 hat die Hochschule für angewandte Wissenschaft St. Gallen in unserem Auftrag eine Befragung dazu gemacht. Das Resultat war, dass die Einwohner mehrheitlich mit uns zufrieden sind und dass wir im Quervergleich mit anderen Gemeinden gut dastehen. Wir möchten diese Erhebung in ein bis zwei Jahren wiederholen.
Welchen Handlungsbedarf hat der Gemeinderat ausgemacht?
Morf: Zu nennen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise die Entsorgung. Viele Bürger haben sich gefragt, warum sie ihre Grünabfälle selber zur Entsorgungsstelle in Gattwil bringen müssen. Wir prüfen nun die Einführung einer Grünabfuhr. Zudem werden wir die Entsorgungsstelle erneuern und die Öffnungszeiten anpassen. Aktuell kann noch zu jeder Zeit Altmaterial gebracht werden, was zu unsachgemässer Entsorgung oder zu Lärmimmissionen für Anwohner führen kann. In diesem Bereich konnten wir aus der Erfahrung anderer Gemeinden wertvolle Ideen in die Planung miteinbeziehen
Steffen: Ein weiteres Thema ist der nach wie vor fehlende Begegnungsplatz in Nottwil. Auf einer Parzelle entlang der Kantonsstrasse ist gegenwärtig eine Überbauung ausgesteckt, die auch ein Gesundheitszentrum mit Arztpraxis und komplementärmedizinische Angebote vorsieht. Zudem bleibt die stete Optimierung der Kommunikation ein Dauerthema. Die Digitalisierung schreitet voran, weshalb etwa auch die Website überarbeitet worden ist. Das Informationsorgan «Nottwil Aktuell» wird jedoch weiterhin gewünscht.
2006 lebten knapp 3000 Menschen in Nottwil. In diesem Jahr nun konnte der viertausendste Einwohner mit der Geburt eines Kindes begrüsst werden. Ist ein solch rasantes Wachstum noch gesund für eine Gemeinde?
Steffen: Ich finde die Entwicklung grundsätzlich gut, hat sie doch dazu beigetragen, dass Nottwil die Finanz- und Steuerkraft und das Eigenkapital signifikant hat erhöhen können. Auch ist es uns gelungen, den Steuersatz auf mittlerweile 1.85 Einheiten zu senken. Nun haben wir eine gute Grösse erreicht, um die Angebote, die uns und der Bevölkerung wichtig sind, auch finanzieren zu können.
Morf: Im kantonalen Vergleich sind wir schon recht stark gewachsen. Doch das Wachstum hat die grossen Investitionen der vergangenen Jahre überhaupt erst möglich gemacht. Zu erwähnen ist etwa der Bau des neuen Schulhauses und die Sanierung der bestehenden Bildungs-Infrastrukturen, die unter anderem mit dem Zurückholen der dritten Sekundarstufe von Buttisholz und aufgrund der heutigen Anforderungen an den Unterricht nötig geworden sind.
Wie hat sich Nottwil die 50 Millionen Franken, die seit 2006 investiert worden sind, leisten können?
Morf: Die Erhöung der Steuerkraft dank der Neuzuzüger hat sicher dazu beigetragen. Die Bautätigkeit hat auch zu entsprechenden Sondersteuern geführt. Nottwil gehört zu den Gemeinden mit den grössten Investitionen in den vergangenen Jahren.
Steffen: Mitte der Nullerjahre hat die Gemeinde zudem viel eigenes Land verkaufen können. Das Wachstum hat die Investitionen in diesem Ausmass erst möglich gemacht.
Musste die Gemeinde investieren, um mit dem Wachstum überhaupt noch schritthalten zu können?
Morf: So würde ich das nicht sagen. Das Wachstum hat sicherlich eine Rolle gespielt, doch beispielsweise die Erweiterung der Schulräume war schon lange das Ziel, weil man alle Schulstufen in Nottwil haben wollte. Und die Gemeindeverwaltung hat man so oder so zweckmässig und zeitgemäss umbauen wollen, um ein weiteres Beispiel zu nennen.
Hat Nottwil die Steuerkraft durch viele Neuzuzüger oder durch vereinzelte Reiche erhöhen können?
Steffen: Beides trifft zu. Wir sind beispielsweise immer bestrebt, zusammen mit dem SPZ darauf hinzuwirken, dass dessen Kaderleute möglichst auch in Nottwil wohnen. Wir haben es aber auch geschafft, vereinzelt Steuerzahler hier anzusiedeln, die namhafte Beträge beisteuern.
Morf: Es ist uns aber gelungen, keine Klumpenrisiken zu schaffen. Hängt eine Gemeinde nur von wenigen sehr guten Steuerzahlern ab, kann ein Wegzug einschneidende Auswirkungen haben.
Wie viele Steuern zahlt eigentlich ein Schweizer Paraplegikerzentrum?
Steffen: Die Schweizer Paraplegikerstiftung, zu der das SPZ gehört, ist steuerbefreit. Hingegen leisten verschiedene Unterfirmen wie die Ortotec oder das Hotel Sempachersee Unternehmenssteuern. Auch hat Nottwil dank guter Verträge mit dem SPZ attraktive Nutzungen der Infrastrukturen für Bevölkerung und Sportvereine erreichen können. Das Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem SPZ ist eine Win-Win-Situation.
Morf: Das SPZ ist aber auch ein wichtiger Partner für die Gemeinde bei Projekten, war es doch zum Beispiel auch beteiligt an der Realisierung der betreuten Alterswohnungen hinter dem Zentrum Eymatt. Ich denke, dass Nottwil ohne das SPZ auch nicht die selbe gute Anbindung an das öV-Netz hätte wie heute.
Aus dem kleinen, landwirtschaftlich geprägten Nottwil ist mit dem starken Wachstum seit den 80er-Jahren ein langgezogenes Dorf ohne Zentrum geworden. Fehlt nicht etwas der Charakter?
Morf: Die Feststellung, dass durch die vergangene Bautätigkeit eine gewisse Verzettelung stattgefunden hat, stimmt sicher. Dies wollen wir nun aber mit der nächsten Ortsplanungsrevision, welche die Siedlungsentwicklung und Verdichtung im Innern betont, ausgleichen.
Steffen: Nottwil verfügt heute über einen interessanten Bevölkerungsmix. Ein eigentlicher Begegnungsplatz – der Wunsch nach einem solchen wird immer wieder geäussert – fehlt in der Tat noch immer. Ich muss aber auch darauf hinweisen, dass die Gemeinde viele Orte der Begegnung kennt, beispielsweise das Seebad, das Carib-
bean Village, das Zentrum Sagi, das SPZ oder das Zentrum Eymatt.
Morf: Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Begegnungsplatz ist zwar von der Mehrheit der Stimmbevölkerung abgelehnt worden. Doch schon ein paar Monate später kamen wieder die Stimmen auf, die danach fragten.
Und wo schlägt der Gemeinderat nun diesen Begegnungsplatz vor?
Steffen: Wir sind nach wie vor vom Potenzial des Parkplatzes «Chelematte» überzeugt, denken nun aber an eine schöne Überbauung, in deren Zentrum ein Raum für Begegnungen entstehen könnte. Die heutige Parkierung könnte unterirdisch erfolgen. Entsprechende Ideen sind wir am Entwickeln.
Nottwil ist in den vergangenen Jahren gewachsen, hat aber gleichzeitig Dienstleistungen wie die Postfiliale oder den bedienten Bahnschalter verloren. Eine eigentlich gegenteilige Entwicklung …
Steffen: Zu erwähnen ist noch der Weggang des Hausarztes, was auch geschmerzt hat. Doch mit dem geplanten Gesundheitszentrum versuchen wir hier nun Gegensteuer zu geben. Der Gemeinderat hat sehr für den Erhalt der Post und des Bahnschalters gekämpft. Doch wir haben einfach sehen müssen, dass das heutige Kundenverhalten die notwendigen Frequenzen nicht mehr gebracht hat. Auch ich löse meine öV-Tickets heute am Smartphone. Bei der Post haben wir aber die Agenturlösung im Spar finden können.
In Nottwil gibts auch keine Dorfbeizen mehr.
Morf: Das stimmt, doch auch andere Gemeinden verzeichnen genauso die Schliessung traditioneller Gastronomiebetrie. Nottwil ist also längst nicht alleine vom Phänomen des Beizen-
sterbens betroffen.
Steffen: Nottwil hat aber weiterhin ein vielfältiges Gastronomieangebot mit dem Café Mühle, dem Lindenpub, dem Bahhöfli und den Restaurants des Hotels Sempachersee. Auch kann man sein Feierabendbier gut in der Beachbar, der Seebadi oder beim Campingplatz genehmigen. Aber klar: Eine richtige Dorfbeiz wie das Rössli früher fehlt schon.
Was würden Sie als typisch Nottwil, als Identität der Gemeinde bezeichnen?
Steffen: Das ganzheitliche Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, guter Erschliessung und sonstigen Dienstleistungen für alle Generationen. Auch verfügt Nottwil über ein reiches gesellschaftliches Leben, wenn man etwa an die vielen Vereine denkt. Aber auch die bekannten Gesundheitsinstitutionen mit nationaler und internationaler Ausstrahlung gehören zu Nottwil.
Morf: Der Standort spricht für sich. Zudem hat Nottwil auch mit 4000 Einwohnern immer noch eine persönliche Note und einen dörflichen Charakter.
Nottwil strebt nun das Goldlabel als Energiestadt an. Setzt die Gemeinde also weiterhin und noch verstärkt auf ökologisches Bewusstsein und Nachhaltigkeit?
Morf: Das kann man sagen, ja. Beim letzten Reaudit vor drei Jahren erfüllte Nottwil knapp 70 Prozent der Vorgaben. Seither haben wir etwa die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Zentrums Sagi gebaut, ein neues Schulhaus aus Holz erstellt und einen Wärmeverbund realisiert. Für das Goldlabel braucht es eine Übereinstimmung bei drei Vierteln der Vorgaben. Die Chancen stehen gut für das nächste Reaudit im 2021.
Was bringt ein solches Label den Bürgerinnen und Bürgern?
Morf: Dieses Label ist zwar sicher ein Aushängeschild für die Gemeinde, muss aber auch gelebt werden! Als Energiestadt ist man immer gehalten, am Ball zu bleiben. Dies sensibilisiert und motiviert die Bevölkerung auch. Die plastikarme Gemeinde ist ein Beispiel. Es ist eigentlich ganz einfach: Was man nicht braucht, muss man nicht beschaffen oder entsorgen. Das ist etwa auch bei der Energie oder beim Wasser so.