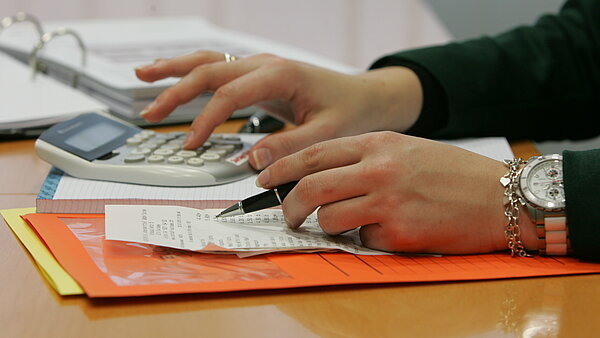Peter Kirchschläger, am Freitag ist Tag der Arbeit. Welche Bedeutung hat dieser Tag in der aktuellen Krise?
Die aktuelle Krise führt uns vor Augen, wie verletzbar der Mensch ist. Der Lockdown hat eine ökonomische Dimension, viele Leute können nicht arbeiten, sie haben existenzielle Ängste, die Arbeitslosigkeit steigt. Der Lockdown tangiert aber auch die sinnstiftende Dimension der Arbeit. Arbeit strukturiert unseren Alltag, ermöglicht soziale Kontakte und Begegnungen. Das fehlt uns jetzt.
Mit welchen ethischen Fragen konfrontiert das Virus die Wirtschaft?
Die aktuelle Situation verlangt, dass wir uns selbst und andere schützen, um Menschenleben zu retten. Die Folgen sind starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens und grosse wirtschaftliche Schäden. Welche Einschränkungen sind wir gewillt in Kauf zu nehmen und für wie lange? Was wiegt höher, Menschenleben oder eine globale Wirtschaftskrise? Aus ethischer Perspektive hat ein Mensch eine bedingungslose Würde, keinen quantifizierbaren Wert. Wenn der Schutz von Leben zu wirtschaftlichen Einschnitten führt, müssen wir das in Kauf nehmen. Denn die Wirtschaft dient dem Menschen, nicht umgekehrt.
Auch wenn das von der Wirtschaftskrise hervorgerufene menschliche Leid gewaltig sein wird?
Natürlich müssen wir die ökonomischen Konsequenzen des Lockdowns im Auge behalten und betroffenen Menschen helfen – in der Schweiz und global. Die UNO geht davon aus, dass sich die Zahl hungerleidender Menschen durch die Coronakrise verdoppeln wird.
Was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn gewisse Berufe als systemrelevant bezeichnet werden?
Die Frage ist, ob alle systemrelevanten Berufe auch monetäre Wertschätzung erfahren. Klatschen für Menschen in Gesundheitsberufen ist eine schöne und wichtige Geste. Gemessen an ihrer Relevanz bräuchte es bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für Pflegende. Ob dieser Diskussion dürfen wir aber nicht vergessen, dass auch zahlreiche Berufe, die nicht systemrelevant sind, schwer unter den Folgen der Krise leiden. Es ist wichtig, dass die Hilfsmassnahmen alle Betroffenen einschliessen.
Welche Themen sollten uns im 21. Jahrhundert am Tag der Arbeit beschäftigen?
Die Digitalisierung setzt bezahlte Arbeitsplätze unter Druck. Eher früher als später werden sie von Maschinen und künstlicher Intelligenz wegrationalisiert. Weil am Arbeitsplatz neben dessen ökonomischer Bedeutung unter anderem auch soziale Integration geschieht, sollten wir dieses Thema gezielt angehen. Dass Menschen an vielen Orten auf der Welt unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, sollte uns ebenfalls zu denken geben. Nach wie vor lassen multinationale Konzerne mit Sitz in der Schweiz Kinder und Erwachsene unter sklavenähnlichen Umständen für sich arbeiten. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Menschenrechte global durchgesetzt werden. Im Dienste des Klimaschutzes sollten wir unser wirtschaftliches Handeln an der Nachhaltigkeit ausrichten. Nicht zuletzt wegen der Digitalisierung, die gewaltiger Energiemengen bedarf.
Durch das Coronavirus erfährt die Arbeitswelt einen weiteren Digitalisierungsschub. Wie sieht unsere Arbeitswelt in 20 Jahren aus?
Das Ziel der digitalen Transformation ist klar: Sie will dem Menschen die Arbeit nicht erleichtern, sondern ihn ersetzen. Darin unterscheidet sie sich von früheren technologiebasierten Umbrüchen. Unternehmen wollen nicht, dass die Kassiererin dank Selbstbedienungskassen weniger Stress hat, sondern Löhne einsparen. Zurückhaltend gerechnet, müssen wir davon ausgehen, dass es in 15 bis 20 Jahren rund 20 Prozent weniger bezahlte berufliche Aufgaben gibt – offensiv gerechnet bis zu 50 Prozent. Dies nicht nur bei beruflichen Aufgaben, die wenig oder keine Qualifikation voraussetzen, sondern zum Beispiel auch in der Medizin. Behandlungen durch Roboter sind günstiger als menschliche Arbeitskräfte, und die Technologien dazu bereits heute vorhanden.
Die Digitalisierung birgt mehr Risiken als Chancen?
Die digitale Transformation umfasst ethische Chancen und Risiken. Problematisch wird die Digitalisierung von Arbeit dann, wenn der Mensch aus der Wertschöpfungskette fällt und ihm die finanziellen Mittel fehlen, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Was heisst es für den sozialen Frieden, wenn Jugendliche eine Ausbildung machen ohne Perspektive auf eine bezahlte Arbeit? Es ist wichtig und dringend, dass wir uns als Gesellschaft solchen Fragen stellen.
Wo stehen wir heute diesbezüglich?
Die digitale Transformation durchdringt die Arbeitswelt schon längst. Dank sinkender technologischer Kosten beschleunigt sich der Wandel zunehmend, und die Machtkonzentration der Konzerne nimmt zu. Bislang haben wir es aber nicht geschafft, unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem darauf auszurichten. Es ist zu hoffen, dass wir die Aufarbeitung der Coronakrise auch dahingehend nutzen und eine Diskussion über die Arbeitswelt von morgen führen.
Sie sehen die Lösung in einem Gesellschaftsmodell, das von einem bedingungslosen Grundeinkommen ausgeht. Was steckt dahinter?
Fallen bezahlte berufliche Aufgaben im grossen Stil weg, benötigen wir ein Grundeinkommen, das nicht nur unsere Existenz sichert, sondern uns ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Bedingungslos ist es allerdings nicht: Wer ein Grundeinkommen empfängt, soll sich gesamtgesellschaftlich in einem frei gewählten Bereich einbringen. So, wie wir es vom Zivildienst kennen. Dieses Modell nenne ich Society-, Entrepreneurship-, Research-Time (SERT). Die Society-Time, die wir für den Dienst an der Gesellschaft aufbringen, lässt einen unter anderem die Sinnstiftung von Arbeit erfahren. Wer sich unternehmerisch, in Bildung oder in Forschung engagiert, wird von seiner Society-Time befreit, so dass gleichzeitig Anreize für Innovation und Unternehmertum gesetzt werden.
Welche Chancen bietet ein solches Arbeitsmodell?
Wir hätten Zeit, uns Fragestellungen zuzuwenden, die gesamtgesellschaftlich wichtig wären –zum Beispiel dem Klimaschutz oder der globalen Armut. Die digitale Transformation zeigt, dass sich Innovation zum Schlechten entwickeln kann, wenn sie nicht mit demokratischen Mitteln begleitet und gesteuert wird. Der Mensch muss seine Verantwortung wahrnehmen und die Digitalisierung so gestalten, dass die Menschenwürde aller Menschen gewahrt bleibt.
Sind Sie zuversichtlich, dass uns das gelingt?
Ja, die Menschheit hat schon bewiesen, dass sie das technologisch Machbare nicht einfach umsetzt, sondern auch der Ethik Platz einräumt. Ein Beispiel ist die Nukleartechnologie, die heute weltweit geregelt ist. Es ist sicher keine perfekte Lösung, doch zumindest ist es der Menschheit gelungen, Schlimmeres zu verhindern. Ähnlich sollten wir über digitale Transformation und künstliche Intelligenz denken.
Ethik des Digitalen
Peter Kirchschläger ist Professor für theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik an der Universität Luzern. In seiner Forschung beschäftigt sich der gebürtige Wiener unter anderem mit der ethischen Perspektive der Digitalisierung, Automatisierung und Robotisierung. Kirchschläger ist Mitglied der Arbeitsgruppe Mobility 4.0 des Eidge-
nössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) und berät nationale und internationale Organi-
sationen in ethischen Fragen.
Die etwas andere Kundgebung
Zum Tag der Arbeit am 1. Mai strahlt die Pfarrei Sursee aus dem «Studio Einsiedlerhof» erstmals einen Livestream aus. Unter dem Titel «Die etwas andere Kundgebung» lädt Giuseppe Corbino, Erwachsenenbildner der Pfarrei Sursee, zur Gesprächsrunde ein. Es nehmen teil: Walter Ulrich (Geschäftsleiter Möbel Ulrich), Peter Wyder (Geschäftsführer Auto Wyder AG) und Peter Kirchschläger.
Nach einleitenden Gedanken von Peter Kirchschläger diskutiert Giuseppe Corbino mit seinen Gästen über die ökonomischen und ethischen Aspekte des Tags der Arbeit. Der Livestream ist zu finden auf der Website der Pfarrei (www.pfarrei-sursee.ch) und wird am Freitag, 1. Mai, um 19 Uhr ausgestrahlt.