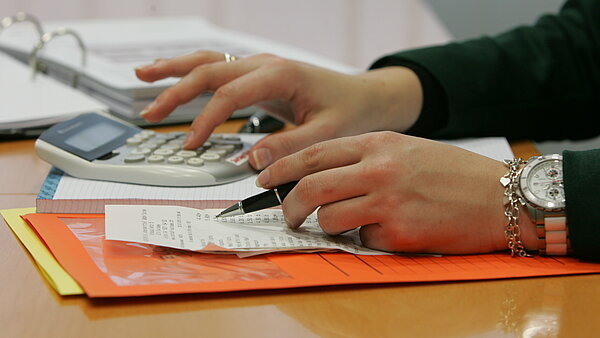2002 begann Ebbe Nielsen seine Tätigkeit als stellvertretender Kantonsarchäologe. Zwei Jahre später berichtete diese Zeitung über die Erforschung von 15 Pfahlbausiedlungen im Sempachersee, die zwischen 4400 und 800 v. Chr., in der Jungsteinzeit und Bronzezeit, entstanden sind und wegen der Erosion sowie des stärkeren Wellenschlags nach der Seeabsenkung von 1806 stark gefährdet seien.
Das Beil vor Eich
Ebbe Nielsen erklärte: «Wir können nicht mehr machen, als die Funde zu dokumentieren.» Stolz zeigte er ein gut erhaltenes und seltenes Beil aus der Frühbronzezeit (2000 v. Chr.), das vor Eich aufgespürt wurde. Weiter berichtete er noch von einem in Sempach gefundenen frühbronzezeitlichen Bronzedolch und mahnte: «Die notwendigen Schutzmassnahmen für den Erhalt dieses bedeutenden Kulturerbes sollten nicht in eine ungewisse Zukunft verschoben werden.»
«Die Zinnbarren von der Siedlung Zellmoos sind einmalig auf dem europäischen Kontinent.»
Die 2004 beauftragte Tauchequipe der Stadt Zürich fand beim Gammainseli einen spätbronzezeitlichen Zinnbarren. Dieser Fund gehöre eindeutig zur Kategorie der unscheinbaren, aber besonders wichtigen Funde, wertete Ebbe Nielsen. «Da Zinn in den Alpen nicht ansteht, waren die Menschen hierzulande ab der Bronzezeit vollständig abhängig von Rohmaterialien aus fernen Gebieten und somit Handel», erklärte er 2015 dazu in der Zeitschrift «Archäologie der Schweiz». Zinnfunde seien in der europäischen Bronzezeit recht selten. Der Zinnbarren verdeutliche die Bedeutung der Siedlung Zellmoos und sei einmalig auf dem europäischen Kontinent.
Der Glasarmring aus Sursee
2008 publizierte er den Aufsatz «Helvetier am Wauwilermoos und am Sempachersee». Einen keltischen Glasarmring vom nördlichen Stadtgraben, keltische Bronzemünzen vom Käppeliacher und ein Eisenschwert von der Moosgasse (alle in der Stadt Sursee) beschrieb Ebbe Nielsen darin.
Am 7. März 2007 hielt der Archäologe im Rahmen einer Vortragsreihe über die Archäologie den Vortrag «Die ersten Bewohner im Raum Sursee». Für diese Zeitung fasst er zusammen: «Vor über 16’000 Jahren lebten schon Rentierjäger hier. Das waren Jäger und Sammler, die das topografisch und ökologisch attraktive Gebiet mit Seen, das auch ideal zum Jagen war, schätzten.» Das Thema Pfahlbauer boomte im gleichen Jahr dank der SRF-Sommerserie «Die Pfahlbauer von Pfyn». Eine Grabung der Kantonsarchäologie und der Universität Bern auf der Halbinsel Zellmoos wurde damals von rund 400 Personen besucht.
Die Öfen aus dem Zellmoos
2011 mündeten die Grabungserfolge der Archäologie im Prädikat «WeltkulturerbePfahlbauten». Aus der Region ist Sursee Zellmoos mit einer jungsteinzeitlichen Phase um 4000 v. Chr. und drei spätbronzezeitlichen Phasen zwischen 1000 und 800 v. Chr. dabei. Spektakuläre Befunde sind etwa Öfen und Hausgrundrisse. Diese Öfen seien die bisher einzigen bekannten der Schweiz aus dieser Zeit (1000 bis 900 v. Chr.), so Nielsen.
«Die archäologische Ausbeute ist im Hofstetterfeld ausserordentlich ergiebig.»
Seitdem gibt es Informationstafeln beim Zellmoos, und der nun scheidende stellvertretende Kantonsarchäologe betonte damals, «dass die Welterbe-Pfahlbauten für die Öffentlichkeitsarbeit und zum Beispiel auch für den Schulunterricht eine herausragende Bedeutung haben könnten.»
Die Keltin vom Hofstetterfeld
Im selben Jahr richtete die Kantonsarchäologie den Blick auf das Hofstetterfeld in Sursee, bevor das Gebiet überbaut wurde. Schon beim Bau der A2 vor 1980 tauchten unweit hiervon bronzezeitliche Gräber auf. Ebbe Nielsen nimmt an, dass es eine Art «Wirtschaftsgebiet der Pfahlbauer» war. Römische Urnengräber, unter anderem mit Bronzeringen und weiteren Beigaben wurden hier freigelegt. Hinzu kam eine bronzezeitliche Strasse, ein aussergewöhnlicher Befund. Schwieriger zu finden sei dagegen das Grab einer reich ausgestatteten «noblen Keltin» gewesen, die bei ihrem Tod 20- bis 25-jährig und lediglich 1,55 Meter gross war.
2014 beschrieb Ebbe Nielsen die Keltin in «Archäologie Schweiz» ausführlich. Die im Hofstetterfeld begrabene Frau trug Armreife sowie mehrere Ringe aus massiver Bronze und Silber. Sie kleidete sich in Leinen und Felle, wie es die sorgfältige Ausgrabung preisgab. «Die Schmuckgegenstände ergaben eine Datierung des Grabes in die Zeit um 300 v. Chr.», schrieb er und fügte nüchtern an: «Das neu entdeckte frühkeltische Frauengrab ist eines der Highlights der Grabung.» Die «archäologische Ausbeute» sei im Hofstetterfeld ausserordentlich ergiebig.
In etwa zur gleichen Zeit starteten Grabungsarbeiten auf dem Vierherrenplatz und benachbarten Gelände des ehemaligen «Zofi» in Sursee. 2013 legten Archäologen 250 Grabensembles, Terrakottapferdchen und die «Titus-Inschrift» offen. Diese Grabung gewährte jedoch einen noch viel tieferen Einblick in die Geschichte – in die Frühgeschichte von den Neandertalern bis zu den Kelten, Ebbe Nielsens Arbeitsbereich.
Die Bergkristalle aus den Alpen
Seinen Hunger nach neuen Erkenntnissen nährte der Vierherrenplatz, unterhalb der «römischen Schicht». Im nächsten Jahr veröffentlichte er eine Monografie zum Mesolithikum (Mittelsteinzeit) am Vierherrenplatz. Dieser Zeitung verriet er erste Ergebnisse. «Um 8500 vor Christus, in der frühen Nacheiszeit, gab es an der Sure eine kurze einmalige Besiedlung. Erstaunlicherweise unterhielten diese Leute damals offenbar insbesondere intensive und weitreichende Fernverbindungen nach Südbayern und dem Vorarlberg.» Funde von Silex (Feuerstein), die geologisch analysiert werden konnten, bringen ihn zu dieser Aussage. Gesteinsmaterial aus der Westschweiz, Bergkristall aus den Alpen und sogar aus dem Tessin und aus Norditalien unterstützten ebenfalls die These der Fernverbindungen.
«Um 8500 vor Christus, in der frühen Nacheiszeit, gab es an der Sure eine kurze Besiedelung.»
Ebbe Nielsen geht davon aus, dass die kleine Familie an der Sure durch Familienclans und Stammesverbindungen Kontakte ins heutige Ausland hatte. «Die zahlreichen Funde lassen jedenfalls vermuten, dass sie kein Zufall waren.»
Zellmoos bleibt in Erinnerung
Wenn Ebbe Nielsen auf die vergangenen 18 Jahre Tätigkeit in der Region zurückblickt, bleibt ihm – neben den europäisch bekannten Siedlungen im Wauwilermoos – besonders das Zellmoos in Sursee in Erinnerung. «Dort entdeckten wir bei den erwähnten Grabungen mit der Uni Bern wunderbare Befunde.» Neben den erwähnten Öfen listete er in der Heimatkunde Wiggertal 2012 ein Depot mit zahlreichen Armringen, das früher entdeckt wurde, und die Neufunde von importierten Perlen aus Glas und Bernstein sowie einmalige Hausgrundrisse auf. Sein grosser Wunsch wäre es, dass es gelingt, diese herausragende «Welterbe-Fundstelle» möglichst unversehrt zu bewahren.