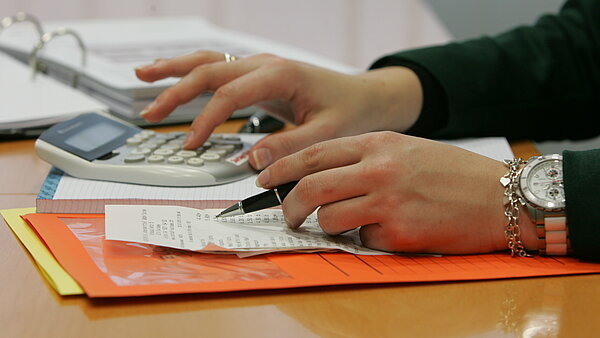Schon in meiner Kindheit, zu einer Zeit also, da noch niemand von «Food Waste» sprach, war das Thema Lebensmittelverschwendung beziehungsweise -vergeudung in unserer Familie regelmässig ein Thema. «Hartes Brot ist nicht hart, aber kein Brot ist hart», pflegte meine Mutter jeweils zu sagen, wenn ich mich über ein nicht mehr ganz frisches Stück Brot beklagte oder nicht aufessen wollte, was auf den Tisch kam. Die Botschaft war klar: Mit Lebensmitteln geht man mit Respekt und Umsicht um, gibt es auf der Welt doch genug Menschen, die jeden Tag Hunger leiden oder gar an Unterernährung sterben.
Einfache Grundregeln
Um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken oder um diese zumindest zu minimieren, gibt es ein paar einfache Grundregeln, die es zu beherzigen gilt. Nur so viel einkaufen, wie man innert nützlicher Frist auch konsumieren kann – und im Idealfall bevor das Mindesthaltbarkeits- oder Endverbrauchsdatum abläuft –, ist eine davon. An diese Regel halte ich mich seit jeher, gehe ich doch nur einkaufen, wenn ich etwas benötige, und auch nur so viel, wie ich bis zum nächsten Einkauf verbrauchen kann. Zugegeben, für einen Ein-Personen-Haushalt wie meinen ist das einfacher zu bewerkstelligen als für eine Grossfamilie. Da kommt es auf eine gute Planung an.
Den Sinnen vertrauen
Viele Lebensmittel landen im Abfall, weil ihr Endverbrauchsdatum abgelaufen ist. Dieses ist jedoch meist nicht so sakrosankt. Manche Lebensmittel sind auch nach dessen Ablauf durchaus noch geniessbar – vorausgesetzt, sie wurden sachgerecht aufbewahrt, etwa im Kühlschrank, in Plastik- oder Alufolie oder sonst einem schützenden Behältnis. Bier zum Beispiel ist in der Regel noch Wochen nach dem Ablauf des «Best Before End»-Datums trinkbar, wenn man es gekühlt und abgeschottet von Licht aufbewahrt hat. Was verderbliche Lebensmittel angeht, so lohnt es sich, seinen Sinnen zu vertrauen: Wenn etwas zu schimmeln anfängt oder komisch riecht, ist es reif für den Kompost. Dort macht es sich als Biomasse nützlich, was immer noch besser ist, als in der Kehrichtverbrennungsanlage zu landen.
Alles kann man nicht haben
Seit einiger Zeit kaufe ich den Kaffeerahm nur noch in den kleinen Plastik-Kübelchen. Die können dem Kaffeerahm in den Kunststoffflaschen ökologisch zwar nicht ganz das Wasser reichen. Dafür muss ich jetzt nicht mehr bis zur Hälfte des Inhalts in den Schüttstein schütten, weil der Kaffeerahm mangels genügend schnellen Verbrauchs «öberegheit» ist. Dieses Beispiel zeigt: Alles kann man nicht haben; gewisse Kompromisse muss man eingehen. Kreativität hingegen kann nicht schaden. So erwischte ich kürzlich beim Take away für die Fischknusperli statt des Döschens mit Tartarsauce eines mit Salatsauce – und tunkte die Knusperli und die Pommes einfach in die Salatsauce. Eine ganz neue und eher spezielle Geschmackskombination, aber immer noch besser, als die Salatsauce in den Müll zu werfen.
«Schnäderfräsigkeit» als Hürde
Sollten jedoch trotz aller Bemühungen Essensreste übrig bleiben, gibt es im Internet zig Ideen und Anregungen, solche Reste sinnvoll zu verwerten. Bekanntlich soll die italienische Landesspeise, die Pizza, der Idee entsprungen sein, einen Teigfladen mit Resten zu belegen und das Ganze im Ofen knusprig zu backen. Und mit Wehmut erinnere ich mich heute noch an die herrlichen Aufläufe, die es zu Hause gab und oftmals ebenfalls der Resteverwertung entsprangen.
Schwieriger ist es mit der sogenannten «Schnäderfräsigkeit». Als bekennender Verschmäher von Tomaten und Salatgurken musste ich für einmal über meinen Schatten springen, um nicht aufgrund persönlicher Abneigungen Food Waste zu begehen. Aber immer funktioniert solcherlei Disziplin leider nicht: Wenn etwa die Jalapeno-Sauce zum (Take-away-)Tartar auf der Scoville-Skala in derart astronomische Höhen klettert, dass mein Gaumen nicht mehr mitmacht (und der ist sich in Sachen Schärfe so einiges gewohnt), gibt es einfach nichts anderes als die Waffen zu strecken – und die Sauce dem Kompost zu übergeben.
Kleine Portionen tun es auch
Doch nicht nur im eigenen Haushalt kann man etwas gegen Food Waste tun, sondern auch beim auswärts Dinieren. Wessen Hunger klein ist, der oder die sollte auch nur etwas Kleines essen oder eine kleine Portion bestellen. Und am Buffet im Ferienhotel nur so viel auf den Teller laden, wie er oder sie auch essen kann. Für mich eine Selbstverständlichkeit, ist es das für viele Leute offensichtlich keineswegs, wie eigene Beobachtungen abgeräumter Lebensmittelberge in Ferienhotels immer wieder zeigten.
Fazit: In Bezug auf Food Waste war mein persönlicher Fussabruck schon vor diesem Selbstversuch nicht der grösste. Ich brauche mein Verhalten also nicht grundlegend zu ändern. Es gibt aber durchaus noch Spielraum, die Bilanz zu optimieren – vor allem wenn es um die «Schnäderfräsigkeit» geht.
Zahlen und Fakten
Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum produziert wurden und auf dem Weg vom Bauern bis auf den Teller verloren gehen oder weggeworfen werden, nennt man «Food Waste». Dies können zum Beispiel aussortierte, unförmige Früchte, ungenutzte Nebenprodukte wie Innereien, Lagerungsverluste, zu grosse Portionen und Buffetüberschüsse, abgelaufene Produkte sowie Essensreste oder der letzte Schluck in der Flasche sein.
Ein Drittel aller Lebensmittel geht über die ganze Lebensmittelkette betrachtet verloren. Dies entspricht in der Schweiz 330 Kilogramm pro Person und Jahr, also insgesamt 2,8 Millionen Tonnen – oder der Ladung von 150’000 LKW, die aneinander gereiht eine Kolonne von Zürich bis nach Madrid ergeben. Davon verursachen die Verarbeitungsindustrie 35, die Haushalte 28, die Landwirtschaft 20, der Gross- und Detailhandel 10 und die Gastronomie 7 Prozent. Insgesamt werfen wir in der Schweiz pro Person und Jahr 620 Franken des Haushaltsbudgets weg.
Schweiz versus Kamerun
Interessant ist, dass in der Schweiz, wo nur 7 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel ausgegeben werden, die Haushalte 28 Prozent des Food Waste verursachen. In Kamerun etwa ist es gerade umgekehrt: Dort werden 45 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel aufgewendet, aber nur 5 Prozent des Food Waste gehen auf die Kappe der Haushalte.
Food Waste ist ein wichtiger Treiber der Klimaerwärmung. Je weiter hinten in der Lebensmittelkette vom Bauern bis auf den Teller die Lebensmittelverluste anfallen, desto mehr belasten sie das Klima. Deshalb lässt sich über die Hälfte der Klimaeffekte von Food Waste einsparen, indem man die Lebensmittelverschwendung in Haushalten und Gastronomie stoppt.