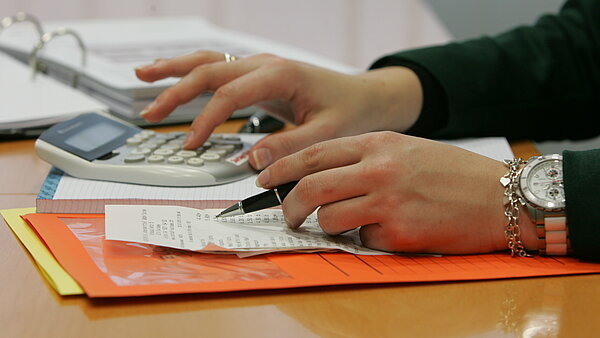Die Covid-19-Pandemie wütet besonders stark in Italien. Fernsehbilder aus norditalienischen Spitälern haben uns geschockt: Patientenbetten in den Gängen, machtlos daliegende Menschen unter Sauerstoffhauben oder an Atemgeräten, rastlos herumeilende Ärzte und Pflegende. Der Kampf um Leben und Tod dauert nun schon zwei Monate. Tag und Nacht, bis zur Erschöpfung: da eine Pflegefachfrau, die auf ihrem Schreibtisch eingeschlafen ist, dort ein Arzt, der beim Interview die Tränen kaum zurückhalten kann. Was wir nicht sehen: die Augen, die sich schliessen und nicht mehr öffnen. Das Land unserer Ferienträume wird auf eine harte Probe gestellt, wieder einmal. Wir erinnern uns an frühere Naturkatastrophen: verheerende Erdbeben (das letzte grosse 2016, schon fast vergessen!), sintflutartige Unwetter, einstürzende Brücken. Dazu aus den Nähten platzende Migrantenlager und die Mafia, die immer dort aus ihren Löchern kriecht, wo soziale Unruheherde entstehen und der Staat zu
spät kommt. Dieser Staat tut sein Möglichstes, macht auch Fehler,
entwickelt aber ein selten gesehenes Zusammengehörigkeitsgefühl, manch-
mal sogar unter den streitsüchtigen Politikern.
Als der Schwarze Tod wütete
Wir können noch weiter zurückschauen in die Geschichte. 1347/48 wütete in Italien der Schwarze Tod, die wohl schlimmste Pest, die sich je über Europa ausgebreitet hat. Ihren Ursprung hatte sie in der von Tataren belagerten Stadt Caffa auf der Halbinsel Krim. Tatarische Belagerer warfen ihre Pesttoten über die Mauern in die Stadt, genuesische und venezianische Handelsleute brachten die Krankheit nach Italien. Ein Drittel, so schätzen die Historiker, kam in Europa damals ums Leben. Ein Vergleich mit heute ist nur bedingt zulässig. Die Pest war eine bakterielle Seuche, keine Virusepidemie. Man kannte den Erreger und die Kausalzusammenhänge nicht; erst 1894 entdeckte der Westschweizer Alexandre Yersin das nach ihm benannte Pestbakterium «Yersinia pestis» und beschrieb die Übertragungswege (Flöhe auf Nagetieren).
Als der Pöbel dahinsiechte
Interessante Parallelen zu heute stellt man fest in den sozialen und psychologischen Folgen der Seuche auf die Reaktion der Menschen. Reiche und Mächtige sonderten sich ab, während der Pöbel auf der Strasse dahinsiechte und einen einsamen Tod starb. Nächstenliebe, die christliche Caritas, mag es auch gegeben haben, der stärkste Trieb allerdings war die Selbsterhaltung, nach dem Prinzip «sauve qui peut»! Hier bietet sich heute ein anderes Bild, Differenzieren ist aber von Nöten. Unsere Welt ist vielfach vernetzt. Wir erfahren täglich die neuesten Meldungen, Erklärungen und Kommentare, erhalten Bilder und Videos aus allen Ländern. Unzählige Beispiele gelebter Solidarität hellen die Horrormeldungen auf: der aufopferungsvolle Einsatz des Spitalpersonals, der Kuriere und der Transporteure, das Engagement der Freiwilligen, der Mut gewisser Arbeiterinnen und Arbeiter, trotz Ansteckungsrisiko weiterhin zur Arbeit zu gehen. Aber da sind auch die andern: Die ewig Uneinsichtigen, die mit ihrem gedankenlosen Freiheitsdrang die Schutzvorschriften der Behörden ignorieren, oder die Betrüger und Wucherer, die aus der Krise schamlos Profit ziehen.
Die Fratze der Selbsterhaltung
Der natürliche Selbsterhaltungstrieb zeigt seine Fratze: Man streitet sich im Supermarkt um einen rar gewordenen Konsumartikel, Behörden befürchten Revolten von verzweifelten und Hunger Leidenden. In Süditalien werden bereits Supermärkte von der Polizei bewacht. Und was unsichtbar bleibt, weil es im Versteckten, in der Psyche gewisser Menschen passiert: aufgestauter Frust, das Gefühl der Ohnmacht, Kompensation durch Übergriffe und Gewalt. Die Menschen des
14. Jahrhunderts glaubten den Theologen und den Scharlatanen, welche die Pest mit der Strafe Gottes oder mit geheimnisvollen Erddämpfen erklärten. Da sind wir heute zum Glück etwas weiter, auch wenn eine ausgewogene Orientierung in der Informationsflut äusserst anspruchsvoll ist.
Und was uns auch hilft, nicht schwermütig zu werden, das sind die vielen lustigen und empathischen Lebenszeichen, die sich die Menschen in (relativer) Isolation zusenden: Da singen Leute gemeinsam von den Balkonen, spenden Beifall an die Adresse des Pflegepersonals, kreieren erheiternde, herzerfrischende Comics oder Videos. Die Fantasie treibt wunderbare Blüten. Ein junger Mann beschallt mit seiner E-Gitarre von den Dächern Roms die Piazza Navona mit einer Melodie von Ennio Morricone, wie in einem Western, aber kein einziger Cowboy reitet über die Steppe, dafür plätschert der Dreiströme-Brunnen in Einsamkeit vor sich hin. Nicht weit davon entfernt verteilt ein Priester im Schutzanzug Essen an Bedürftige.
«Triumph des Todes»
Ein erst 2018 aufwendig restauriertes Fresko mit dem Titel «Triumph des Todes» ist im Camposanto (Monumentalfriedhof) von Pisa installiert worden. Es wurde von einem Maler namens Buffalmacco im 14. Jahrhundert geschaffen. Seine Ausmasse sind beeindruckend: 8 x 15 Meter. Die dargestellte Todesvision ist eine Variante der auch bei uns bekannten Begegnung der drei Lebenden mit den drei Toten. Die Legende ist in unserem modernen Bewusstsein verblasst, so wie die noch schemenhaft lesbaren Fresken in der romanischen Kirche von Kirchbühl (Sempach).
Der Freskenzyklus im Camposanto von Pisa ist ein für uns heutige Menschen verstörendes Bild, ein ultimatives «Memento mori». Es stellt die harte Frage nach der Auseinandersetzung von uns Lebenden mit dem Tod. Im «Triumph des Todes» sind vier Personengruppen dargestellt: Eine vornehme Jagdgesellschaft, die unvermittelt auf drei Särge trifft, in denen bereits verwesende Tote liegen, reagiert entsetzt und verängstigt. In einem anderen Bildteil liegen Tote aller sozialen Schichten übereinander; Engel entreissen ihnen ihre Seelen in Form von nackten Kinderkörpern. Eine andere Gruppe zeigt jüngere Leute in fröhlicher Stimmung und genussvoller Lebensfreude. Sie wissen noch nichts von der Gefahr. Im oberen Teil des Bildes gehen Mönche in Einklang mit der einfachen Natur ihren Beschäftigungen nach: Einer melkt eine Hirschkuh, ein anderer meditiert oder betet. Und im Hauptteil des Freskos wird der «Dies irae» heraufbeschworen, der Tag des Zorns: Der Tod, eine Sensefrau (la Morte!) beherrscht die Szene, rings herum machen sich Engel und Teufel die Seelen streitig.
Lachen als Überlebensstrategie
Das eindrückliche Fresko wurde schon früh mit dem berühmten Novellenband «Il Decameron» von Giovanni Boccaccio (1349–53 entstanden) in Zusammenhang gebracht. Darin gibt es einige Geschichten, in denen ein Maler namens Buffalmacco mit gaunerhaften oder naiven Zeitgenossen seine Spässe treibt. Die Rahmenhandlung erzählt, wie eine Gruppe junger Leute vor der Pest in Florenz auf ein benachbartes Landgut flüchtet, um sich dort, wohl versorgt mit Speis und Trank, Geschichten zu erzählen. Aber denken Sie nichts Böses! Da wird nicht Party gefeiert. Boccaccio gelingt in seinen Novellen eine meist humorvolle, aber sozialkritische Beschreibung der Gesellschaft: kleine und grosse Halunken, Hochstapler, Verbrecher aus allen sozialen Schichten geben ein trauriges Bild der Welt ab, werden aber zuweilen übertölpelt oder schaufeln sich selber ihr Grab.
Solche Geschichten zu erzählen und darüber zu lachen ist eine Überlebensstrategie. Was dabei herauskommt, bildet einen Markstein des im 14. Jahrhundert beginnenden Humanismus und ein Frühlingsbeet für die europäische Erzählliteratur. In Bezug auf das Fresko aus Pisa besteht kein direkter chronologischer Zusammenhang, weder mit Boccaccio noch mit der historischen Pest. Das Fresko entstand nach neuerer Erkenntnis der Kunstgeschichte vor der Pestepidemie, zwischen 1336 und 1338. Die Frage nach dem Tod aber lag in der Luft, beschäftigte offensichtlich Künstler und Intellektuelle.
Was lehrt die Geschichte?
Fragen wir uns abschliessend, ob wir aus der Geschichte etwas lernen können. Ein seriöser Vergleich, z. B. zwischen der Pest von 1348 und der jetzigen Sars-CoV-2-Pandemie, kann auf gewisse Problematiken aufmerksam machen – unter der Bedingung, dass man gleichbleibende von veränderlichen oder zeitgebundenen Phänomenen trennt. Lernen können wir auch aus den mehr oder weniger wissenschaftlichen, den philosophischen, den theologischen und soziologischen Betrachtungen, mit denen uns die Herausgeber historischer Werke konfrontieren. Und mit der Schönheit ihrer Präsentation: Welch ein Vergnügen, welch ein Trost, wenn man Ruhe und Musse findet, einige Novellen aus dem «Decameron» zu lesen oder einen Bildband über einen Renaissance-Maler durchzublättern.
Der Freiburger Historiker Volker Reinhardt gibt seiner eben erschienenen Kulturgeschichte Italiens (Verlag C. H. Beck, 2019) den Titel «Die Macht der Schönheit». Im hektischen Arbeitsalltag, kumuliert mit Freizeit- und Konsumstress, hat eine meditative, genussvolle Beschäftigung mit Geschichte und ihren Geschichten durchaus einen Lerneffekt. Jetzt haben nicht alle, aber viele von uns die Zeit dazu.
In der Phase nach der Pandemie werden (hoffentlich) die Lehren gezogen: Vorsorgen, Vorräte an medizinischem Material anlegen, ins Gesundheitswesen und in die medizinische Forschung investieren, Forschungsergebnisse breiter diskutieren, Solidarität leben, auch wenn es den meisten gut geht. Es erstaunt schon, wie in Italien nach dem «Schwarzen Tod» hierarchisch organisierte Städte und Machtzentren alteingesessener Familien (u. a. Visconti in Mailand, Este in Ferrara, Gonzaga in Mantua, Montefeltro in Urbino, Medici in Florenz) bei moderater wirtschaftlicher Entwicklung die wissenschaftlichen und kulturellen Höhenflüge des Humanismus und der Renaissance ermöglichten. Dem heutigen Italien ist zu wünschen, dass die schwierigen Verhandlungen mit der EU um wirtschaftliche Aufbauhilfe nach der Krise zu einem beidseits befriedigenden Ergebnis gelangen: Europa hat Italien mehr zu verdanken als nur Pizza und Gelati.