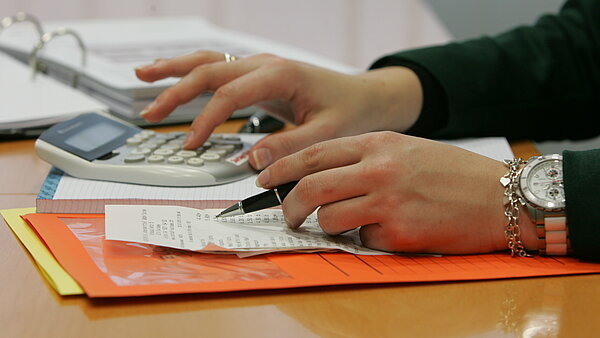Nach über 20 Jahren revidiert die evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Luzern ihre Kirchenordnung. In diesem Kontext sucht sie den Dialog und lädt am Samstag, 27. Februar, zur digitalen Grossgruppenkonferenz ein. Bisher haben sich bereits 190 Vertreter aus Kirche, Politik, Wirtschaft, Kultur, Verwaltung und dem Gesundheitswesen angemeldet.
Grundsätzlich geht es bei der Revision um die Frage, wie das kirchliche Zusammenleben in Zukunft gestaltet werden soll und welche Funktionen die Kirche dabei ergänzend zum Staat und zur Wirtschaft übernimmt. Ein zentrales Thema, das dabei auch diskutiert wird, liegt in der Seelsorge, die insbesondere in der aktuellen Krisensituation an Bedeutung gewinnt. Ulf Becker, Synodalrat und Pfarrer in Reiden, verweist darauf, dass die Diakonie als Dienst am Nächsten und damit auch die christliche Seelsorge seit den Anfängen des Christentums besteht. «Viele Leute verbinden Seelsorge mit Sterbebegleitung, doch das Gebiet ist viel umfassender», so Becker. Es gehe darum, zuzuhören und Menschen zu begleiten, die sich in schwierigen wie auch freudigen Situationen befänden.
Schwierige Situationen hat auch die nun seit einem Jahr anhaltende Corona-Pandemie heraufbeschworen. Durch die Schutzmassnahmen des Bundes sähen sich viele Leute vor der Situation, ihre alltäglichen Kontakte nicht mehr in gleicher Weise pflegen zu können, viele soziale Netze kämen zum Erliegen, sagt Becker. «Für die Kirche ist die Krise eine Chance, da zu sein und Menschen zu begleiten bei Einsamkeit oder der Sorge um die Gesundheit, den Arbeitsplatz usw.»
Patienten sehnen sich nach Kontakt
Besonders prekär stellt sich die Situation aktuell in medizinischen und pflegerischen Bereichen dar. Ursula Walti, Seelsorgerin des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil, weiss, dass es eben diese sozialen Kontakte sind, welche die Patienten und Patientinnen oftmals nach einem Unfall und der damit verbundenen Krise durch die Reha tragen. Weil Angehörigenbesuche zurzeit oft nicht möglich seien, sehnten sich viele Patienten nach einem persönlichen Gespräch mit Spitalseelsorgenden. «Als Seelsorgerin hatte ich noch nie so viel Patientenkontakt wie jetzt», sagt Walti.
Wer ins Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil kommt, befindet sich aufgrund schwerer Verletzungen in einer lebensverändernden Situation. «Wenn dann während einer mehrmonatigen Reha kaum Besuchende zugelassen sind, bedeutet das eine grosse seelische Belastung. Gleichzeitig sind viele querschnittgelähmte Menschen quasi Profis im Umgang mit grossen Einschränkungen. Von ihren Erfahrungen könnte die Gesellschaft in der aktuellen Pandemie-Situation einiges lernen», führt Walti aus.
Michael Döring-Wermelinger, Departementsleiter Pflege und Soziales des Luzerner Kantonsspitals, ergänzt, dass die Seelsorge nicht nur im Umgang mit den Patienten eine wichtige Rolle einnimmt. Sie wirkt auch als wichtige Schnittstelle zwischen Angehörigen und Patienten wie auch in den Teams. «Die Seelsorgenden haben Zeit, hören zu und stehen in einem besonderen Vertrauensverhältnis», sagt Michael Döring-Wermelinger. Er macht in der gegenwärtigen Situation auch in den Spitälern einen klar steigenden Bedarf nach Kontakt mit den Seelsorgenden aus. «Ängste und Unsicherheiten nehmen zu, und die kirchlichen Seelsorgenden sind als Pfarrpersonen gewohnt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Neben den medizinisch-pflegerischen Leistungen tragen wir Sorge zum Menschen in seiner Gesamtheit. Dazu gehört auch die Begleitung der Seelsorgenden», so Döring-Wermelinger.
Spiritualität kann Trost bieten
In einer Krisensituation ist es eine natürliche Reaktion, nach Halt und Orientierung zu suchen. Existenzielle Fragen tauchen auf. Viele Menschen fragen dann nach dem Sinn und der Bedeutung des Erlebten und Erlittenen. «Die Seelsorge unterstützt Patienten und Angehörige auf ihrer spirituellen Suche und hält gemeinsam mit ihnen Ausschau nach dem, was sie tröstet und stärkt. Als Christen beziehen wir uns auf einen Gott, der sich in den unterschiedlichen Situationen immer wieder neu zeigt und uns Kraft sowie Hoffnung schenkt. Glaube bedeutet das Vertrauen, dass es in allem Wandel auch eine Beständigkeit gibt. Etwas, das fest bleibt und uns auch als Gesellschaft zusammenhält», erklärt Ursula Walti.
Welche Wünsche und Hoffnungen haben nun die Teilnehmenden mit Blick auf die Erneuerung der Kirchenordnung? «Beständigkeit bedeutet nicht Starrheit», sagt Ulf Becker. Die Revision der Kirchenordnung biete die Möglichkeit, die Stärken der Kirche im Dialog herauszukristallisieren. «Dies ist auch ein reformiert-demokratischer Grundwert, sich an den Bedürfnissen der Menschen zu orientieren und sich zu erneuern. Zuversicht und Hoffnung zu spenden sind Anliegen, die wesentlich zum kirchlichen Auftrag gehören und natürlich beibehalten werden müssen», so Becker.
Und Michael Döring-Wermelinger beobachtet, wie die Menschen unterschiedliche Formen der Spiritualität für sich entdecken. Doch sei es eine vielseitige und vielschichtige Spiritualität, was von der Kirche berücksichtigt werden müsse. Dass die digitale Konferenz bewusst an dieser Stelle ansetzt und alle Menschen eingeladen sind, sei mutig. «Es ist auch die Chance, in der aktuellen Krise der Frage nachzugehen, was es ist, das uns als Gesellschaft verbindet und die Menschen Gemeinschaft erleben lässt», so Döring-Wermelinger.
Die Seelsorge stehe nicht nur Mitgliedern einer bestimmten Glaubensgemeinschaft zur Verfügung, sondern engagiere sich über Konfessionen und Weltanschauungen hinweg und sei für alle Menschen da, erklärt Ursula Walti. Sie betont deshalb den gemeinsamen Weg: «Ich wünsche mir eine Kirche, die es schafft, der individua-lisierten Gesellschaft Kitt zu geben, und die uns zusammenhält.»
Kirche lädt zum Dialog ein
Die evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Luzern lädt am Samstag, 27. Februar, zum öffentlichen Dialog ein. Im Dialog geht es um das künftige Zusammenleben und was Kirche gesellschaftlich leisten soll. Auch Bildungs-, Kultur-, Unterrichts- und Jugendangebote sind zu diskutieren. Anmeldung bis am 21. Februar unter www.reflu.ch/dialog.