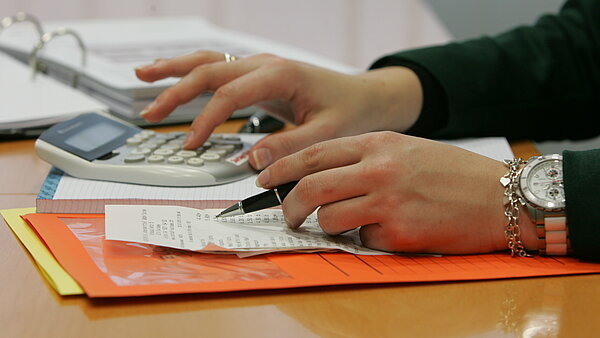«Ohne die künstliche Aufzucht würden wir heutzutage keine Balchen mehr fischen», sagt Berufsfischer Andreas Hofer aus Oberkirch. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er die Fischerei Hofer in der dritten Generation. Bereits in den Fünfzigerjahren stellte Gottfried Hofer, der Grossvater der beiden Brüder, eine Verschmutzung des Sempachersees und den damit verbundenen Rückgang der Biodiversität fest. Aus diesem Grund liess Gottfried Hofer ein eigenes Bruthaus zum Erbrüten und Aufziehen von Jungfischen erbauen. Um die Bestände von Hecht, Seeforelle und vor allem Balchen auch heutzutage im Sempachersee aufrechtzuhalten, erbrüten die Hofer-Brüder jährlich um die 40-50 Millionen Fischeier. Denn wegen dem Menschen haben einige Fischarten in der natürlichen Fortpflanzung kein leichtes Spiel. «Durch die Überdüngung von Landflächen wird viel Phosphat in den See eingetragen. Dies fördert stark das Algenwachstum im See. Sterben die Algen ab, sinken sie auf den Grund und zehren beim Abbauprozess viel Sauerstoff. Balchen laichen im Freiwasser, sprich: ihre Eier sinken auf den Grund. Wegen den Algen steht ihnen dort nicht ausreichend Sauerstoff zur Verfügung, weswegen ein grosser Teil der Eier abstirbt», nennt Andreas Hofer den Hauptgrund für die künstliche Aufzucht.
Eier aus Bauchhöle drücken
Die Fischeier werden durch das Abstreifen der Laichfische gewonnen. Im Winter gehen die Brüder Hofer auf den See, um die Laichfische zu fangen. Ein Teil der gefangenen Balchen ist laichreif. «Wir halten den Rogner, also den weiblichen, laichreifen Fisch, auf dem Rücken und drücken die Eier aus der Bauchhöhle raus. Die Eier kommen in einen Kessel, dem wir den Samen vom Milchner, dem männlichen, geschlechtsreifen Fisch, beifügen.» Nach dem Abstreifen werden die Fische getötet und anschliessend verarbeitet.
Die Laichsaison der Balchen dauert etwa von Dezember bis Februar. Die abgestreiften Eier kommen in die acht Liter Wasser fassenden Zugergläser, denen ständig Seewasser für die optimale Sauerstoffversorgung zugeführt wird. «Je wärmer das Wasser ist, desto schneller schlüpfen die Jungfische. Bei den Balchen sprechen wir von 300 Tagesgrad. Das heisst, bei einer Seewassertemperatur von fünf Grad Celsius schlüpfen die Fische nach 60 Tagen», erklärt Andreas Hofer. Die etwa zehn Millimeter grossen Fischlarven schwimmen über den Rand der Zugergläser hinaus und sammeln sich in einem Becken. Dort werden sie mit Plankton (Kleinkrebsen) aus dem Sempachersee gefüttert. Bald darauf wird der grösste Teil der kleinen Jungfische im See ausgesetzt.
Froh um gefiederte Fressfeinde
Einen Teil der Larven entlassen die Hofers in fünf je acht Kubikmeter Wasser fassende Würfelnetze. Dort ist für ausreichend Futter gesorgt: Eine ständig leuchtenden Neon-Röhren zieht das Plankton an. Ein schöner Anblick für Andreas Hofer, wenn er die vielen Jungbalchen, die in den Netzgehegen während 90 Tagen zu einer Grösse von circa fünf Zentimeter herangewachsen sind, sieht. «Der Respekt vor den Tieren ist uns besonders wichtig», sagt er. Seit 30 Jahren lebt er vegetarisch, doch der eigene Fisch kommt ihm noch auf den Tisch. An der harten Arbeit als Berufsfischer, die nicht mit dem Angeln verglichen werden kann, gefällt ihm vor allem die Verbundenheit zur Natur. «Mein Vater gab meinem Bruder und mir den Grundsatz «Hegen und Pflegen» mit auf den Weg. Wenn wir also durch das Fischen von der Natur profitieren, geben wir ihr mit der Aufzucht auch wieder etwas zurück.» Auch die Wut einiger Angler auf Kormorane, Haubentaucher, Fischreiher und Co. kann Andreas Hofer nicht verstehen. Er ist sogar froh, wenn es viele gefiederte Fressfeinde der Fische in der Region gibt: «Viele Haubentaucher bedeutet, dass es viele Fische im See gibt. Ausserdem hat ein Tier die grösste Berechtigung darauf, einen Fisch zu fangen. Anders als wir Menschen können einige Tiere nicht ohne dieses Nahrungsmittel überleben.»