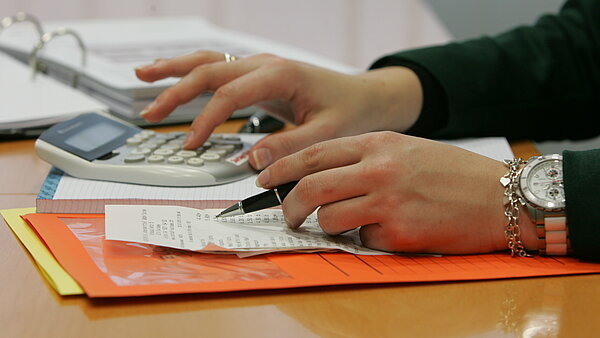Die nächste Phase des Phosphorprojekts startet Anfang 2021. Die dazugehörige Verordnung tritt am 1. Januar in Kraft, auch wenn noch eine Beschwerde von Landwirten am Kantonsgericht hängig ist (Ausgabe vom 12. November). Dass der Kanton den Hebel noch stärker ansetzt bei den Massnahmen zur Reduktion des Phosphoreintrags in die Mittellandseen, wozu auch der Sempachersee zählt, hat seinen guten Grund. Ging man bis anhin davon aus, dass ein Phosphorgehalt von 30 Milligramm pro Kubikmeter Wasser ausreicht, um eine mittlere Produktion von Biomasse zu erreichen – diese garantiert, dass es nicht wieder zu überhöhtem Algenwachstum und somit zu einem ungenügenden Sauerstoffgehalt vor allem in den Tiefen des Sees kommt –, weiss man es nun besser. «Umfangreiche wissenschaftliche Arbeiten haben gezeigt, dass der bisherige Zielwert deutlich zu hoch angesetzt ist», sagt Andrea Muff, Fachspezialistin Kommunikation des kantonalen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD). Mit einer Phosphorkonzentration von 20 bis 30 mg/m3, die in den letzten Jahren im Sempachersee gehalten werden konnte, sei die Produktion von Biomasse so hoch, dass die Anforderungen an die Wasserqualität nicht erreicht würden, sagt Muff.
Zielwert wurde halbiert
Das widerspiegelt sich nun auch im Jahresbericht zum Zustand des Sempachersees 2019, welcher der Redaktion vorliegt. Um den Vorgaben der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung zu genügen, sind die Ziele der Seesanierung für den Zeithorizont bis 2035 angepasst worden. Der Zielwert für die Phosphorkonzentration, der bisher bei 30 mg/m3 lag, ist halbiert worden und liegt neu bei 15 mg/m3.Bisher lag der Grenzwert für die jährliche Fracht an Phosphor in den See bei 4,7 Tonnen. Neu ist er auf 4 Tonnen jährlich festgelegt worden.«Wissenschaftliche Arbeiten des Wasserforschungsinstituts Eawag der ETH und der EPFL zeigen, dass die Phosphorkonzentration in den Seen für eine höchstens mittlere Produktion von Biomasse im Bereich von 10 bis 15 mg/m3 Wasser liegen muss», macht Andrea Muff deutlich.
Belüftung bleibt vorderhand
Die Sauerstoffkonzentration wird im Tiefenwasser weiterhin mit 4 Milligramm/Liter und an der tiefsten Stelle mit 1 mg/l angestrebt. Seit dem grossen Fischsterben in den 80er-Jahren sorgt der Gemeindeverband Sempachersee mit der künstlichen Belüftung des Sees dafür, dass die Sauerstoffverhältnisse im Gewässer bessern. Andrea Muff vom BUWD sagt klar: «Die seeinternen Massnahmen reichen für sich alleine nicht aus, um den Sauerstoffgehalt auf das vorgeschriebene Niveau zu erhöhen.» Die Belüftung mit Umgebungsluft im Sommer und die Umwälzung im Winter, um die Zirkulation zu unterstützen, müssten so lange betrieben werden, bis der See als Lebensraum und Ökosystem wieder funktioniere.
Trockenheit schönte Bild
Die seeinternen Massnahmen des Gemeindeverbands unterstützen die Gesundung des Sees, die aber massgeblich dadurch beeinflusst wird, wie viel Phosphor in den See gelangt. Hier kommt der Kanton ins Spiel, der für die Massnahmen in der Seeumgebung zuständig ist (siehe Kasten). Der Jahresbericht über den Zustand des Sempachersees 2019 belegt, dass im 2018 der Phosphoreintrag mit 3,2 Tonnen eigentlich unter dem jährlichen Zielwert von 4 Tonnen lag. Doch zu verdanken ist diese Tatsache in erster Linie der damaligen grossen Trockenheit. Ist das Wetter hingegen regenreich, gelangt auch deutlich mehr Phosphor in den See. Das zeigt unter anderem, wie stark die Böden imZuströmbereich des Seesnach wie vor mit Phosphor gesättigt sind.
Und dies wiederum heizt die Produktion von Biomasse an, wozu insbesondere das Algenwachstum zählt. Vermodern diese Pflanzenteile auf dem Seegrund, entziehen sie dem Wasser Sauerstoff; ein Vorgang, der nach wie vor anhält und die Seegesundung hemmt. Aus dem Jahresbericht geht auch hervor, dass seit 2012 im Schnitt die Phosphorkonzentration und damit auch der Anteil der Blaualgen wieder ansteigen.
65 Prozent kommt von Bauern
Die Dienststelle Umwelt und Energie misst seit den 80er-Jahren die Einträge von Phosphor in die Seen. Dabei wird unterschieden, aus welchen Quellen der Phosphor stammt. Wie Andrea Muff vom BUWD ausführt, gelangen beim Sempachersee rund 65 Prozent des totalen Phosphoreintrags aus den landwirtschaftlichen Flächen in den See. Aus den Siedlungen kommen rund 10 Prozent via Abwasserreinigungsanlagen und Regenwasserentlastungen. Der Rest gelangt direkt über die Luft in den See, beispielsweise durch Blütenstaub oder Regen. «Eine Herausforderung ist, dass in den 1960er- bis 1990er-Jahren die landwirtschaftlichen Böden massiv überdüngt worden sind», verdeutlicht Andrea Muff. Die Phosphorüberver-
sorgung der Böden sei somit in erster Linie eine Altlast, die nur bedingt mit der heutigen Bewirtschaftung zu tun habe.
Böden sind überversorgt
Aus dieser Optik ist auch zu verstehen, warum Landwirteim Zuströmbereich des Sempacherseeskünftig nur noch maximal 90 Prozent des Phosphorbedarfs ihrer Kulturen abdecken dürfen. Dadurch soll der Phosphorgehalt in den Böden endlich signifikant zurückgehen. «Die Pflanzen sollen das Manko aus dem Boden nehmen», führt Andrea Muff aus. Denn: «Viele Böden im Zuströmbereich der Seen sind sehr gut mit Phosphor versorgt.» Dass künftig weniger gedüngt werden dürfe, führe nicht zu einer Unterversorgung der Pflanzen.