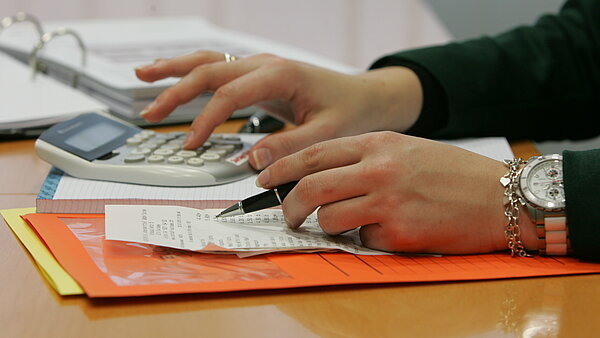«Tatort Sursee: 53 Frauen unschuldig hingerichtet». Unter diesem Titel gingen am letzten Samstag drei Führungen in der Surseer Altstadt über die Bühne, die einen erschütternden Einblick in die Hexenverfolgung des 16. und 17. Jahrhunderts gaben. Und Sursee war eine Hochburg dieser Praxis, welche die Stadtführer Sibille Arnold, Nicole Bättig und Georges Zahno beleuchteten. Die Zahl musste sogar noch nach oben korrigiert werden. Im Zuge der Vorbereitungen der Stadtführung zeigte sich, dass insgesamt 59 Menschen, denen ein Pakt mit dem Teufel und schwarzer Zauber vorgeworfen wurde, zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert ihr Leben lassen mussten – 58 Frauen und ein Mann.
Hexen als Sündenböcke
Die Stadtführer rechneten hoch, was diese schreckliche Zahl an sich bedeutete. Die Stadt Sursee zählte zu dieser Zeit rund 900 Einwohner, knapp 60 davon wurden hingerichtet. Zöge man den Quervergleich mit der damaligen Einwohnerzahl Europas, man wäre auf eine Zahl von Toten gekommen, die mit dem dunkelsten Kapitel des Kontinents, dem Holocaust des Zweiten Weltkriegs, vergleichbar gewesen wäre.
Viele Hexenprozesse und Hinrichtungen passierten in der Zeit zwischen 1625 und 1629 – kein Zufall, denn damals wütete die Pest. Mit den Hexenverfolgungen habe man zu jener Zeit Erklärungen für Unerklärliches gesucht, informierten die beiden Stadtführerinnen und der Stadtführer die rund 30 Leute, die sich bei der Feuertaufe am Samstagvormittag eingefunden hatten. Missernten, Hagelschläge, Krankheiten bei Nutztieren, aber eben auch Seuchen mit vielen Toten wie die Pest, Impotenz oder Unfruchtbarkeit konnten Vorkommnisse sein, auf welche die Menschen Antworten suchten.
Strafe Gottes oder Teufels Werk
Entweder war es eine Strafe Gottes, oder der Teufel und seine menschlichen Helfer – Hexen und Schwarze Zauberer – standen dahinter. Dass jemand des Hexentums und eines Teufelspaktes bezichtigt wurde, hat aber oftmals einfach den profanen Hintergrund von Missgunst, Neid oder Nachbarsstreitigkeiten gehabt. Die Opfer seien oftmals Zugezogene oder Unangepasste gewesen, informierten die Stadtführer, und nicht selten Frauen, welche einen selbstbewussten, selbstständigen und sexuell freizügigen Lebensstil gepflegt hätten. Dies habe man als eine Gefahr für die Göttliche Ordnung empfunden und um diese eben wieder herzustellen, beziehungsweise eine Strafe Gottes von Sursee abzuwenden, habe man die Hexenprozesse angestrebt. Aber grundsätzlich habe es jede und jeden treffen können.
Diebenturm als Zeitzeuge
Der Rundgang der Stadtführung brachte die Gruppe unter anderem zum Diebenturm, auch Hexenturm genannt – «dem einzigen Hinweis auf Hexenverfolgung im öffentlichen Raum in Sursee» - und zum Rathaus, genauer zum Bürgersaal, wo jeweils die Prozesse stattfanden. Dort erläuterten die Stadtführer, welch unsägliches Prozedere und welche grässlichen Qualen die Angeklagten hatten über sich ergehen lassen müssen. Aufgrund von erhaltenen Protokollen ist ersichtlich, dass es sich immer um ähnliche Sachverhalte in den durch Folter erzwungenen Geständnissen – den sogenannten Vergichten – drehte. Deshalb liege die Vermutung nahe, dass vieles vorgeschrieben worden sei und man darauf hingearbeitet habe, von den Hexen zu hören, was man hören wollte.
Folter war weitverbreitet
Was dies bedeutete, enthielten die Stadtführer auch nicht vor. Da wurden die Menschen auf die Streckbank gelegt, Knochen gebrochen oder Gelenke ausgerenkt, Körper am Seil hochgezogen mit Gewichten an den Füssen oder heisse Eier in die Achselhöhlen gelegt, um nur einiges zu nennen. In dem Moment schluckte im Bürgersaal die eine oder der andere leer oder hatte einen Kloss im Hals, wusste man doch, dass diese Praktiken möglicherweise gleich im Nebenzimmer angewendet worden waren. «Die Geständnisse mussten danach immer auch ohne Folter wiederholt werden», erzählte Nicole Bättig. Wer dies nicht tat, der war die nächste Folter gewiss. «Und eine Verteidigung gab es keine.» In Sursee ist auch kein einziger Freispruch bekannt.
Schwert und Scheiterhaufen
Verkündet wurden die Urteile jeweils vor dem Pranger am Rathaus, wo sich die Menschenmassen versammelten. Dann wurden die Hexen in die Münchrüti, dem heutigen Standort der Frischfleisch AG und des Zeughauses gebracht, wo Schwert und Scheiterhaufen warteten. Mit diesen Prozessen habe man auch bezweckt, dass sich das Bild der Hexenvorstellung im Volk festsetzte, um ja nicht das, was man unter der Göttlichen Ordnung verstand, aufs Spiel zu setzen.
Pest löschte halb Sursee aus
Ein weiterer Ort der Stadtführung war die Krypta in der Martinskapelle. Dort macht ein Grabstein deutlich, was die letzte Pest für Sursee bedeutet hatte. 400 der 900 Einwohner verloren damals ihr Leben. Diese Seuche hatte weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen. So stand Sursee monatelang unter Quarantäne Und die Stadt Mailand belegte Sursee mit einem Bann. Wenn dennoch jemand aus dieser norditalienischen Stadt Handel in Sursee betrieb, drohte ihm die Todesstrafe.
Existentiell bedrohliche Situationen führten zu gegenseitigen Verdächtigungen und Verfolgungen. Diese verstärkten noch das Krisengefühl und das Konfliktpotenzial und zerstörten Solidaritäten innerhalb von Nachbarschaften und Gemeinden. Sündenböcke werden auch heute bisweilen gesucht. In der damaligen Zeit der Hexenverfolgung konnte dies einen qualvollen Tod bedeuten.