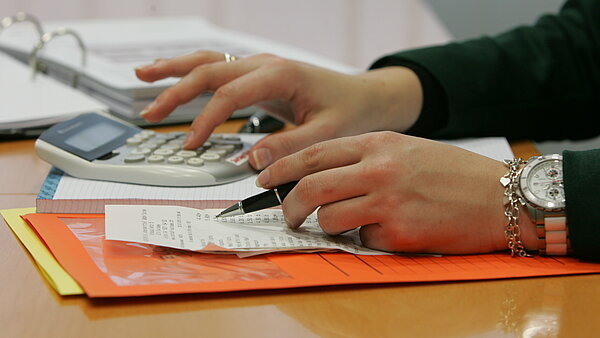Heute schnallen die Autofahrer die Gurte so selbstverständlich an, wie sie beim Abbiegen den Blinker stellen. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung ermittelt jährlich die Gurtentragquote mittels 73 Zählstellen. Im vergangenen Jahr hielten sich 96 Prozent an die Gurtentragpflicht. 1995, vor 25 Jahren, lag diese Quote noch unterhalb der 70-Prozent-Grenze. Übrigens bestraft die Polizei Autofahrer, die keine Gurten tragen, mit einer Strafe von 60 Franken.
Zumutbar und wirksam
Die Schweiz führte die Anschnallpflicht am 1. Juli 1981 ein. Vorausgegangen war eine Volksabstimmung, die am Sonntag, 30. November 1980, stattfand. «Es ist offensichtlich, dass das Gurtentragen die Sicherheit der Autofahrer erhöht», argumentierte der Bundesrat. Trotz aller Empfehlungen würden aber immer noch viele Autofahrer die Gurten nicht tragen. Zudem sei die Pflicht zumutbar, wirksam und liege im Interesse der Allgemeinheit.
Die Gegner hingegen beklagten einen «unzulässigen Eingriff in die persönliche Freiheit». Die Selbstverantwortung solle nicht durch Gesetze eingeschränkt werden. Und: «Sicher-
heitsgurte sind nicht immer ein wirksamer Schutz, ja sie könnten sogar Verletzungen verursachen.»
Westschweiz und Urkantone
Am Abstimmungssonntag votierten alle Westschweizer Kantone, das Tessin sowie die Urkantone gegen die Gurtentragpflicht. Der Kanton Jura, ein Jahr zuvor gegründet, sagte mit 85,5 Prozent Nein. Auf der anderen Seite nahm der Kanton Basel-Stadt die Vorlage mit 75,4 Prozent an.
Im Kanton Luzern stimmten 55,7 Prozent mit Ja. Das Amt Sursee blieb mit 52 Prozent etwas skeptischer. In der Stadt Sursee sagten knapp zwei Drittel Ja. Sempach folgte mit 62 Prozent Ja. In Schlierbach war die Skepsis im Amt am grössten. 74 Prozent legten ein Nein in die Urne.
74 Prozent gegen Gurten
Warum Schlierbach die Gurtenpflicht im Verhältnis 3:1 ablehnte, wollte diese Zeitung vom damaligen Gemeindepräsidenten Theo Schwarzentruber (1978 bis 1983) erfahren. Der heute 88-jährige rüstige ehemalige Posthalter betont, dass die offizielle Gemeinde weder Ja noch Nein empfahl. Er vermutet, dass der Entscheid einem Bauchgefühl geschuldet gewesen sei.
Peter Bühler unterrichtete von 1968 bis 2006 an der Primarschule. «Neuen Vorschriften wurde in Schlierbach schon immer mit Skepsis begegnet», nennt er einen möglichen Grund für die überdurchschnittliche Ablehnung der Gurtentragepflicht. «Ausserdem sind die Schlierbacher ausgesprochen freiheitsliebend und wollten sich von oben nie gerne etwas aufoktroyieren lassen.» Die Unabhängigkeit, welche Schlierbach 1844 erlangte, und der Drang nach Selbstbestimmung wurden seit jeher gross geschrieben. Das zeigte sich auch vor rund 20 Jahren, als aus finanztechnischen Gründen die Idee einer Gemeindefusion herumgeisterte, sagt der 74-jährige ehemalige Dorfschullehrer.
Damals viele ohne Gurt
Werner Funk ist seit 1972 Fahrlehrer. «Das Gurtenobligatorium war wieder eine neue Vorschrift wie heute die Maskenpflicht», macht der Surseer einen Vergleich und einen Versuch, die Skepsis zu erklären. Viele Unfälle habe es gegeben, weil sich nur wenige angeschnallt hätten.
Er befürwortete damals die Anschnallpflicht, in der Fahrschule war sie sowieso zu befolgen. Werner Funk ergänzt, dass es damals noch viele Autos gab, die gar keinen Gurt hatten. «Es war deshalb auch ein Umgewöhnen.» Heute sieht er eine andere Gefahr beim Autofahren. «Die vielen technischen Hilfsmittel suggerieren dem Fahrer, dass ihm nichts passieren kann.» Dem sei aber nicht so. Der grösste Fehler, ergänzt der erfahrene Fahrlehrer, sei das fehlende Vorausschauen beim Fahren.
770 Tote verhindert
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung unterstreicht die Wichtigkeit des Anschnallens: «Der Sicherheitsgurt verdoppelt die Überlebenschance bei einem Unfall. In den vergangenen zehn Jahren vermied das Tragen des Gurtes auf Schweizer Strassen annähernd 7000 Schwerverletzte und rund 770 Getötete», sagt Mediensprecher Nicolas Kessler.