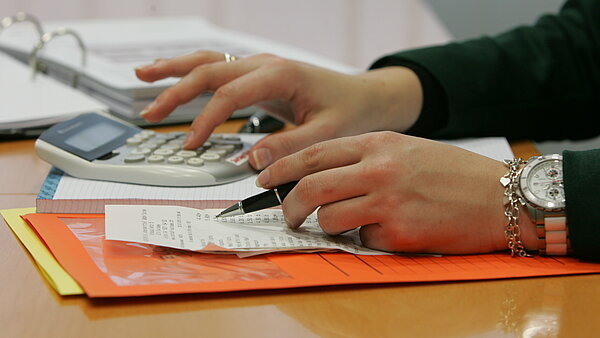Menschen ekeln sich vor Spinnen, liebkosen Katzen, spielen mit Hunden, essen Schweine und Rinder, vergasen männliche Küken: Das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren könnte zwiespältiger und zerrissener kaum sein. Am einen Ende der Skala ist maximale Zuwendung, wenn Hunde beispielsweise zum Coiffeur dürfen oder Katzen am Tische von Frauchen und Herrchen dinieren. Auf der anderen Seite nehmen Menschen in Kauf, dass Tiere gequält oder getötet werden. Ein Beispiel, dass vor Kurzen in den Medien die Runde machte, war die Meldung, dass Deutschland die Tötung von männlichen Küken verbieten will. Hintergrund ist die Tatsache, dass männliche Küken bei der Eier- und Legehennenproduktion keine Verwendung finden und deshalb kurz nach ihrer Geburt mit Kohlendioxid eingeschläfert werden.
«Enormes Spannungsverhältnis»
Mit dem Umgang des Menschen mit Tieren beschäftigen sich auch die Ethiker. Mathias Wirth ist Assistenzprofessor für Systematische Theologie/Ethik und Leiter der Abteilung Ethik an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Laut ihm gibt es in der Tierethik zwei Hauptströmungen, auf der einen Seite den Meliorismus, der den Tierschutz verbessern will und auf der anderen Seite der Abolitionismus, welche jegliche Form der Ausbeutung von Tieren ablehnt. «Wir leben in einem enormen Spannungsverhältnis zu den Tieren», sagt Mathias Wirth. Der Mensch esse Tiere, er kaufe und verkaufe sie. «Wir behandeln diese Lebewesen, als hätten sie keine Würde.» Gleichzeitig sei den Menschen aber auch bewusst, dass es Tieren etwas ausmacht, wie man mit ihnen umgehe. «Es macht für das Tier einen Unterschied, ob wir es vorsichtig behandeln oder ihnen Schmerzen zufügen. Also wägen wir moralisch ab.»
Drei Gründe für Tiernutzung
Der Mensch halte Tiere aus drei Gründen, legt Mathias Wirth weiter dar, «um uns zu ernähren, um medizinische Forschung mit ihnen zu betreiben oder um uns durch sie unterhalten zu lassen.» Zu Letzterem zählen die Haustiere, die aus Sicht des Tierethikers in bestimmten Fällen die noch am wenigsten problembehaftete Art der menschlichen Tiernutzung. Es gebe interdisziplinäre Expertisen, die belegten, dass Tiere als Gefährten für die Menschen eine wichtige Rolle spielen könnten und umgekehrt. «Das hat man exemplarisch auch während der Coronapandemie gesehen. Den von sozialen Kontakten ausgeschlossenen Menschen hat die Präsenz von Tieren gut getan.» Tiere leben hier aber in Abhängigkeitsverhältnis, weil sie gefüttert werden müssen und an menschliche Orte gewöhnt werden. Dennoch gibt es aber auch Haustiere, die hinter verschlossenen Türen viel Leid erfahren.
Wie weit gehen Tierrechte?
Die Tierethik stelle eine weitere zentrale Frage: «Welche weitreichenden Rechte gewähren wir Tieren?», sagt Mathias Wirth. Sind es nicht elementare Rechte, die etwa festlegen, dass man Tiere nicht quälen darf und wie man Tiere in Ställen halten muss? Oder sind es Grundrechte, die den Schutz des Lebens als oberste Maxime festsetzen und – gleich wie bei den Menschen – beispielsweise massive Eingriffe in das Wohlergehen in den meisten Fällen verbieten? «Die Abolitionisten vertreten diese Ansicht», erläutert Mathias Wirth. Laut ihm bedeutet diese Position eine völlige Neuordnung des gesellschaftlichen Lebens, würde man Tieren Grundrechte zuschreiben.
Eingriffe nur bei Alternativlosigkeit
Mathias Wirth vertritt die Ansicht, dass eine Behandlung von Tieren, die ihre ethischen Rechte beschneidet, immer nur dann gerechtfertigt ist, wenn es keine Alternativen gibt. Gerade in der medizinischen Forschung zeigt sich dies deutlich, offenbart aber auch ein Dilemma, in dem sich – zumindest ethisch handelnde – Menschen befinden. «Solange es noch keine digitalen Modelle gibt, welche die Resultate aus Tierversuchen gleichwertig ersetzen, brauchen wir die Tiermodelle noch.» Das sei die ganz grosse Herausforderung für die Forschung an Tieren und genauso für die Tierethik. «Was machen wir mit Tierversuchen beispielsweise in der Entwicklung von Krebsmedikamenten, die Menschen helfen können, die wir lieben?» Man könne es kaum verantworten, nicht das Möglichste für Krebskranke zu tun, auch wenn es probematisch sei, dafür Mäuse unter Umständen sterben zu lassen, sagt Wirth.
Der Mensch als Hilfegemeinschaft
Doch wie begründet er diese Haltung? «Zwischen dem Abolitionismus und dem Meliorismus vertrete ich ein Modell dazwischen: Das der Hilfegemeinschaft.» Der Mensch stehe in einem wechselvolleren Verhältnis zu anderen Mitmenschen als zu Tieren. Das habe damit zu tun, dass Tiere den Menschen nicht in gleicher Weise helfen könnten, so Wirth weiter. «Ein speziell trainierter Hund kann wohl einen Epileptiker in seinem Alltag begleiten. Aber er kann nicht für ihn während eines Anfalls die Feuerwehr rufen, wenn sein Haus zu brennen beginnt.» Deshalb befänden sich die Menschen in einer Hilfegemeinschaft, seien sich in dieser Hinsicht stärker verbunden. «Aufgrund dieses Reziprozitätsunterschieds ist der Mensch erste Wahl», formuliert es Mathias Wirth etwas salopp.
Tierleid höher zu bewerten
Nicht nur die Hilfegemeinschaft bildet einen Unterschied im Verhältnis der Menschen untereinander und jenem zu den Tieren. «Menschen leben auch in einer Moralgemeinschaft», erläutert Mathias Wirth. Sie könnten ihr Tun moralisch abwägen, könnten eine denkende Distanz einnehmen und etwas sein zu lassen, was im ersten Reflex oder aufgrund von Instinkten passieren würde. «Menschen sind Freiheitswesen und sie können nach vorne schauen und zukunftsträchtig planen.» Tiere hätten zwar auch die Freiheit entscheiden zu können, ob sie nun lieber an die Sonne liegen oder auf Futtersuche gehen möchten. «Sie wollen auch glücklich sein, nicht leiden und sich sicher fühlen. Doch sie leben viel unmittelbarer. Für sie zählt nur der Augenblick», macht Wirth deutlich. «Deshalb ist ihr Leid noch höher zu bewerten. Tiere können nicht denken, dass der Schmerz vorbeigeht in ein paar Minuten.» Daraus folgt, so Wirth: «Tiere sind passive Mitglieder der Moralgemeinschaft, Menschen hingegen haben das Potenzial, dies auch in einem aktiven Sinn zu sein.»
Radikale Abolitionisten
Zurück zur Tierhaltung zum Zwecke, den Menschen zu ernähren. Hier zeigt sich auch die Diskrepanz zwischen den Abolitionisten und den Melioristen am deutlichsten. Für erstere sind jegliche Arten, Tieren in ihren Grundrechten einzuschränken, ein No-Go. Daher gibt es für sie auch keine Nutztiere. Denn es liegt nicht im ureigenen Interesse einer Kuh, sich ihr Kälbchen schon kurz nach der Geburt wegnehmen zu lassen, damit es seine Tage in einer Box verbringen kann, bevor es zur Schlachtbank gelangt. Der Meliorist versucht, die Bedingungen in der Tierhaltung immer mehr zu optimieren und tierfreundlicher zu machen, damit Tierhaltung ethisch vertretbar wird.
Veränderungen immer möglich
Auch wenn immer mehr Alternativen für Fleisch, Milch, Ei und Co. auf den Markt kommen, sind die Regale doch immer noch gefüllt mit tierischen Produkten. Solang sich der Schreibende erinnern mag, gehörte Fleisch auf den Tisch und wurde den Menschen in der Werbung erzählt, das Milch gut für die Knochen ist. Gehört die Tiernutzung nicht einfach zum Menschen? So absolut formuliert ist der Satz für Mathias Wirth unhaltbar. «Man muss nicht an etwas festhalten, nur weil man es schon immer so gemacht hat.» Das sei ein sogenannter naturalistischer Fehlschluss. «Wer Tieren nah ist, isst sie nicht.»
Vegane überleben auch
Freilich gehörten gewisse Produkte wie beispielsweise Emmentaler Käse ein Stück weit zum Kulturgut eines Landes. Und die Schweiz sei im Vergleich mit anderen Ländern sehr weit punkto Tierschutzvorschriften. Dennoch: «Wenn es Alternativen gibt, muss man diese ausschöpfen, wenn es das Leid von Tieren mildert oder auch andere negative Folgen reduziert.» Ohnehin brauche der Mensch kein Fleisch, um überleben zu können, das sei ernährungsphysiologisch völlig klar. «Wir können vegan leben, wenn wir wollen.»
Zucht für Hilfeleistungen
Küken in Mastbetrieben, die nach wenigen Tagen schon Gelenkprobleme haben, sind tierethisch unentschuldbar. Dasselbe gilt für Nacktkatzen oder die Hunderasse der Möpse, die Atemprobleme haben. Und wie sieht es der Tierethiker sonst mit der Zucht? Das Ziel der Einflussnahme auf die Entwicklung der Tiere müsse ethisch genau abgewogen werden. «In gewissen Bereichen ist Tierzucht auch ein Kulturgut. Und Tiere würden gezüchtet und trainiert, damit sie im Sinne eines Hilfsgebotes den Menschen helfen könnten. «Solange es noch keinen Roboter gibt, der Lawinenverschüttete genauso effizient findet, wie es Rettungshunde tun, ist es meiner Ansicht nach und im Sinn des Hilfsgemeinschafts-Argument legitim», sagt Mathias Wirth. Sobald aber bei der Zucht, wie auch bei der Nutzung von Tieren zu schmerzen, Leid oder Tod komme, sei dies für die Tierethik unhaltbar.
Das Kind ist näher als der Hund
In einem Fluss schwimmt ein Hund und ein Kind. Beide geraten plötzlich in Not und drohen zu ertrinken. Wen rettet der Mensch, der am Ufer steht und zeuge des Dramas wird, zuerst? Ist es das Kind, weil es um einen Menschen geht. Oder kann es genauso gut der Hund sein, weil alle Lebewesen gleichwertig sind? «Wir würden zuerst das Kind aus dem Wasser holen wollen», ist Mathias Wirth der Meinung, nicht weil den Menschen der Hund egal wäre, sondern weil man sich dem Kind mehr verbunden fühlt. Er argumentiert hier bei diesem Gedankenexperiment wieder mit der Hilfegemeinschaft.
Töten als letztes Mittel
So ist es laut Mathias Wirt aus ethischer Sicht auch vertretbar, dass ein Mensch gegen ein anderes Tier vorgeht, wenn es einen Menschen angreift, zum Beispiel ein Bär in der Wildnis Alaskas. Dann solle man dabei als erstes versuchen auf eine Tötung des Tiers zu verzichten, beispielsweise mit nicht letalen Waffen, wenn die Versorgung des Tiers danach sichergestellt sei. «Doch wenn es um die Frage geht, sterbe ich, stirbt ein Mensch oder muss ich ein Tier töten, um das Leben eines Menschen zu erhalten, dann töte ich als letztes Mittel das Tier.»
Falsch verstandene Krone
Der Mensch sieht sich als Kröne der Schöpfung, was sich in verschiedenen Weltreligionen zeigt. «Auch daraus ist vielen Tieren Leid erwachsen», konstatiert Mathias Wirth. Das sei aber eine problematische Form der Auslegung, was beispielsweise auch den biblischen Satz «Macht euch die Erde Untertan» betrifft. «Wenn wir die Krone und Verwalterin der Schöpfung sind, können wir sie ja nicht schädigen.» Der Satz sei früher fehlinterpretiert worden, stellt Wirth unumwunden fest, befeuert noch von kirchlichen Gelehrten wie Augustinus oder Thomas von Aquin, die einen kategorischen Unterschied zwischen Mensch und Tier gemacht hätten. Sie hätten in die Welt gesetzt, es sei Aberglaube, dass man Tiere nicht töten dürfe. Dabei, meint Wirth weiter, sollte der Satz vom Menschen als Krone der Schöpfung Menschen vor Menschen schützen und nicht Tiere abwerten. Um Letzteres gehe es in diesem Satz überhaupt nicht.
Es gibt Verursacherverantwortung
Gleich millionenfach getötet wurden Nerze in Dänemark im Rahmen der Bekämpfung der Coronapandemie. Dadurch hat man ja bloss die Hilfegemeinschaft der Menschen geschützt und seine Schutzverantwortung wahrgenommen. «Das ist moralisch hochproblematisch», sagt dazu Mathias Wirth. «So bitter diese Handlung, war sie doch auf den ersten Blick nötig, um eine unkontrollierte und massive Verbreitung des Coronavirus einzuämmen.» Doch der Mensch trage auch eine Verursacherverantwortung. Warum lebten überhaupt so viele Nerze auf engstem Raum in Farmen, dass solche Seuchen sich explosionsartig ausbreiten können?, stellt Mathias Wirth die Frage. «Wir sollten Massentierhaltung auch aus diesen Gründen viel kritischer betrachten.»
Ein zurücknehmendes Zuwenden
Was wäre denn grundsätzlich ein guter, ein ethisch vertretbarer Umgang zwischen Mensch und Tier? «Wir sollten uns in einer Art zugewandtes Zurückweichen, im Sinne einer Schonung auf Tiere beziehen», sagt Mathias Wirth. «Bei aller Forschung wissen wir nicht genau, wie es ist, ein Tier zu sein, und wie es sich fühlt, wenn wir dieses oder jenes mit ihm machen.»