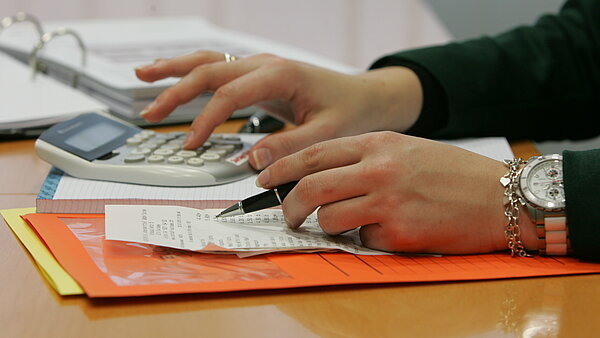Martin Hartmann, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Wie weiss ich, dass ich Ihnen vertrauen kann?
(Überlegt) Sie wissen es nicht, aber Sie haben Anhaltspunkte, weil Sie sich wahrscheinlich mit meinem Lebenslauf beschäftigt oder mein Buch gelesen haben. Auf dieser Basis könnten Sie den Eindruck gewonnen haben, dass ich ein berechenbarer Zeitgenosse bin, der nicht bekannt dafür ist, Menschen zu belügen oder zu missbrauchen.
Ist Berechenbarkeit eine Voraussetzung dafür, dass ich jemandem vertraue?
Berechenbarkeit gehört dazu. Im Alltag ist es aber gar nicht unbedingt notwendig, jedem Fremden zu vertrauen. Die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen, überfordert uns im Einzelfall. Wir setzen eine gewisse Zivilisiertheit oder Verlässlichkeit voraus, wenn wir jemanden kennenlernen. Diese Haltung ist mit weniger hohen Ansprüchen befrachtet, aber eine gute Basis für Vertrauenswürdigkeit.
Wo verläuft die Linie zwischen Verlässlichkeit und Vertrauen?
In der Alltagssprache machen wir diese Unterscheidung nicht. Vertrauen ist aber moralisch gewichtiger. Vertraue ich, gebe ich mir eine Blösse, ich lasse Nähe zu. Ein Vertrauensbruch verletzt. War jemand nicht verlässlich, so bin ich vielleicht sauer oder enttäuscht, aber nicht verletzt.
Sie sprechen in Ihrem Buch (s. Kasten) der Feuerwehr in der Schweiz eine hohe Vertrauenswürdigkeit zu. Weshalb?
Unter anderem zeigen dies Umfragen. Dabei verzeichnen Blaulichtorganisationen oder auch das Schweizerische Rote Kreuz stets hohe Vertrauenswürdigkeitswerte. Diese Institutionen werden als vertrauenswürdig wahrgenommen, weil sie im Interesse des Gemeinwohls handeln. Dem Feuerwehrmann attestieren wir Selbstlosigkeit, das ist für die Einschätzung einer Person oder einer Organisation als vertrauenswürdig sehr wichtig. Die Werte in den Umfragen sind daher eine symbolische Anerkennung einer Organisation.
Sie forschen seit zehn Jahren zum Thema Vertrauen und publizierten im vergangenen Jahr das zweite Buch dazu. Welche Erkenntnisse haben Sie im Verlauf Ihrer Forschung am meisten überrascht?
Zwei Dinge: Als ich 2011 das erste Buch zum Thema veröffentlichte, ging ich davon aus, dass Vertrauen ein Mode-Thema sei. Es wurde aber immer relevanter und hält sich bis heute. Viele Institutionen und Unternehmen haben ein wahnsinniges Interesse daran, das hat uns auch die Coronakrise vor Augen geführt. Maske tragen, Abstand halten, Hände schütteln: Das alles sind Themen, die viel mit Vertrauen zu tun haben. Die zweite Überraschung war eine inhaltliche: Zum einen sehnen wir uns danach, vertrauen zu können. Andererseits haben wir Angst, zu vertrauen, weil es uns verletzlich macht. Im Alltag tun wir sehr viel, um nicht vertrauen zu müssen: Wir sichern uns ab mit Gesetzen, Regulatorien, Vorsichtsmassnahmen – ein Beispiel sind Helikopter-Eltern, die alles im Griff haben wollen. Diese Paradoxie des Vertrauens war neu für mich.
Wie hat sich Covid-19 auf unser Verlangen nach Vertrauen ausgewirkt?
Mit der Corona-Pandemie brach die Selbstverständlichkeit des zwischenmenschlichen Vertrauens weg. Jedes Gegenüber ist nun eine potenzielle Gefahrenquelle. Das hat viele schockiert. Weil die Krise mit so vielen Unsicherheiten beladen ist, fällt es uns schwer, Politik und Wissenschaft zu vertrauen. Vertrauen braucht keine totale, aber eine gewisse Sicherheit. Diese fehlt uns zurzeit.
In Ihrem Buch gehen Sie davon aus, dass es nicht eine, sondern gleich mehrere Vertrauenskrisen gibt.
Die Globalisierung macht uns abhängig von unzähligen Menschen, von denen wir die meisten nicht kennen. Vielen müssen wir vertrauen, können es aber nicht, weil wir ihre Absichten nicht durchschauen. Das ist eine Krise. Andererseits fordern uns die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets heraus. Im digitalen Raum müssen wir Mechanismen entwickeln oder erlernen, wie wir Unbekannten vertrauen können. Dann gibt es aber auch handfeste politische Vertrauenskrisen, zum Beispiel in den USA. In der Schweiz ist die Politik sicherlich weniger stark polarisiert und von Misstrauen geprägt. Das zeigt die Pandemie-Politik des Bundesrats, die zu Beginn des ersten Lockdowns von der Bevölkerung mitgetragen wurde.
Das sieht inzwischen anders aus, Teile der Bevölkerung stehen den Pandemiemassnahmen mit Argwohn gegenüber. Manifestieren sich so Vertrauenskrisen?
Verschwörungstheorien sind oft Reaktionen auf die gewachsene Unsicherheit, in der wir leben, und gehen einher mit einem tiefen Misstrauen in die etablierten Institutionen. Vertrauenskrisen zeigen sich aber auch in einem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis oder in unterlassenen Handlungen. Ich bin unzufrieden mit der Politik, also gehe ich nicht mehr wählen.
Ist Vertrauen eigentlich eine messbare Grösse?
Da bin ich skeptisch, auch wenn die zahlreichen Vertrauensbarometer etwas anderes suggerieren. Vertrauen ist eine gelebte Haltung mit einer Praxis. Umfragen können diese Praxis nur verzerrt wiedergeben. Das zeigte sich am Beispiel des Diesel-Skandals von VW: Wöchentliche Umfragen massen das sinkende Vertrauen in die Autoindustrie. Absurd! Trotzdem fahren immer noch viele mit Diesel-Autos. Verstehen Sie mich nicht falsch: Umfragen können durchaus Stimmungen in der Bevölkerung erfassen. Der Alltag zeigt aber, dass wir oft vertrauensvoller sind, als uns die Umfragen glauben lassen wollen. Forschung zum Thema Vertrauen muss sich deshalb unbedingt auf qualitative, also beobachtende Methoden stützen.
Ist Vertrauen zentral für den Zusammenhalt einer Gesellschaft? Oder anders gefragt: Geht es auch ohne?
Jein. Es gab oder gibt sicher Gesellschaften, die auch trotz niedriger Vertrauenswerte mehr oder wenig gut funktionieren. Kommunistische Staaten zum Beispiel. Ich bin aber überzeugt, dass Vertrauen in die politischen Institutionen und in seine Mitmenschen für eine freie, demokratische Gesellschaft unabdingbar ist.
Kommt die Liebe ohne Vertrauen aus?
Nein, Vertrauen ist konstitutiv für die Liebe. Und für die Freundschaft. Für die Nähe einer Beziehung spielt Vertrauen eine elementare Rolle.
«Die da oben machen ohnehin, was sie wollen» ist ein oft gehörter Ausspruch. Schwindet das generelle Vertrauen in unsere Politiker?
In der direktdemokratischen Schweiz ist der Unterschied zwischen «denen da oben» und «uns hier unten» sicher nicht so gross wie in anderen, weniger demokratischen Staaten. Denn im Idealfall sind «die da oben» ja jene, die wir gewählt haben. Wenn sich breitere Bevölkerungsschichten aber nicht ernst genommen fühlen und ihre Interessen nicht repräsentiert sehen, wird es gefährlich. Die demokratische Teilhabe schwindet oder die Bevölkerung wählt radikaler. Deshalb ist es wichtig, dass «die da oben» alles tun, um nicht als «die da oben» wahrgenommen zu werden.
Sie vertreten die Ansicht, dass es auch heute noch viele vertrauenswürdige Akteure und Institutionen gibt, wir sie aber nicht mehr erkennen. Weshalb?
Wie gesagt: Umfragen erzeugen ein manchmal zu negatives Abbild der Realität. Die meisten Zeitgenossen sind ehrliche, aufrichtige Menschen. Beschleunigung, Informatisierung und ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis machen es uns aber schwierig, die Menschen hinter den Algorithmen zu erkennen. Von Ärzten höre ich oft, dass sie unter den zahlreichen Kontrollinstanzen leiden. «Wieso vertrauen uns die Leute weniger», beklagen sie sich.
Stehen wir uns mit unserem Bedürfnis nach Sicherheit – Stichwort Vollkaskogesellschaft – also selbst im Weg?
Der Abbau von manchen Sicherheitsmechanismen in der Gesellschaft wäre radikal, fände ich aber gut. Sicherheit macht Sinn, sie darf aber nicht zur Entmündigung des Individuums führen. Die Angst vor dem Vertrauen ist für mich deshalb die grösste Krise des Vertrauens. Gerade Covid-19 lehrt uns, dass es keine absolute Sicherheit gibt.
Welche Rolle spielt das Urvertrauen oder das «Gesamtvertrauen, das alle kleinen Dinge umfasst, die schiefgehen können», wie es bei Ihnen heisst?
Ein Urvertrauen in uns selbst und andere ist nicht selbstverständlich, es muss immer wieder geschaffen werden. Es hilft, wenn wir lernen, mit Enttäuschungen und Verletzungen zu leben, wenn wir Sicherheitsmassnahmen, die uns nicht geholfen haben, rückgängig machen. Wir müssen wieder den Mut haben, uns auf Verbindlichkeiten einzulassen, dem Partner zu vertrauen. Eine Konsumhaltung, wie sie uns Tinder vorlebt, macht uns auf Dauer nicht glücklich.
Preisgekröntes Buch
Zur Person Martin Hartmann (52) ist Professor für Praktische Philosophie an der Universität Luzern. 2009 habilitierte er an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zum Thema Vertrauen. Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung kürte letzte Woche sein Buch «Vertrauen. Die unsichtbare Macht» (2020, S. Fischer) durch Publikumswahl zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2021.