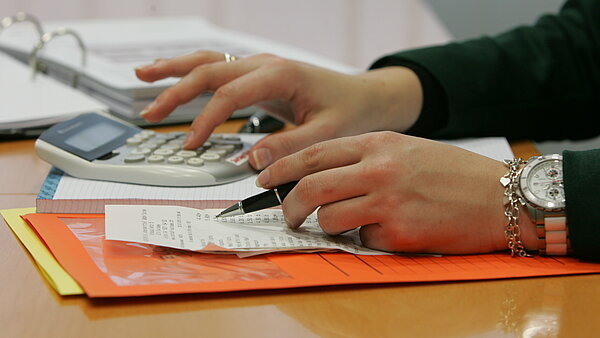«Zukunftsgemeinde» setzt sich für eine resiliente und nachhaltige Zukunft ein. Dabei steht vor allem das Wir-Gefühl im Vordergrund. Der Verein ist davon überzeugt, dass die Lösung eines jeden Problems auf lokaler Ebene und mit gemeinsamem Handeln beginnt. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch das interdisziplinäre Handeln. «Wir glauben daran, dass echter Fortschritt nur durch das gemeinsame Handeln von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und lokalen Organisationen erreicht werden kann», schreibt der Verein auf seiner Website. Auch der Buttisholzer René Ziswiler beschäftigt sich als Initiant von «Zukunftsgemeinde» mit der Lösung von aktuellen Problemen und versucht, neue Ansätze zu finden oder alte neu zu entdecken.
René Ziswiler, an der Veranstaltung «Fit für die Zukunft» von Impuls Surental im Mai sind Sie mit Ihrer Aussage, jede Gemeinde brauche einen See, in Erinnerung geblieben. Ein lokaler See löst in Ihren Augen eine Vielzahl von Problemen. Gibt es denn in Sachen Wohnungsnot auch einen solchen Allrounder?
(lacht) Hier ist es eine Vielzahl von Möglichkeiten, welche in Kombination die Lösung bringen könnten. Wie diese Kombination aussieht, unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde, ja sogar von Quartier zu Quartier. Der «See» in der Thematik Wohnen wäre wohl jemand, der das Thema Wohnen moderiert. Denn das Problem ist, dass Wohnen viel mehr bedeutet als nur Bauen und zurzeit noch zu wenig interdisziplinär betrachtet wird. Ein anschauliches Beispiel sind die Sozialleistungen. Durch Aussen- oder Gemeinschaftsräume etwa kann zur körperlichen und mentalen Gesundheit beigetragen werden. Und wer gesund ist und bleibt, kostet den Staat weniger. Wir sind dieses interdisziplinäre Denken aber noch nicht so gewohnt. Genau deshalb braucht es jemanden, der sich eine fachübergreifende Übersicht verschafft und die Entwicklung anleitet.
Und diese Moderation fehlt momentan?
Ja. Wenn ich mir die Ebene von Verwaltung, Behörden und Politik ansehe, wird mir nicht klar, wer sich ums Wohnen kümmert. So haben wir beispielsweise im Jahr 2013 das nationale Raumplanungsgesetz angenommen. Dazu gehört, dass eine Siedlungsentwicklung nach innen erfolgt. Neubauquartiere zu entwickeln, war einfach. Verdichtung nach innen dagegen ist komplex. Hier braucht es neu jemanden, der eng mit der Bevölkerung, den Immobilienbesitzern und der Wirtschaft zusammenarbeitet und die Innenverdichtung aktiv vorantreibt.
Tun das die Gemeinden nicht bereits?
Ich kann nicht in jede Gemeindestruktur hineinsehen. Wenn ich aber beispielsweise als Aussenstehender bei den Gemeinden der Region nachsehe, ist für mich nicht ersichtlich, wer und wie man sich um die Wohnproblematik kümmern will. Nehmen wir beispielsweise Sursee, ein Entwicklungsschwerpunkt des Kantons. Wenn ich im Legislaturprogramm der Stadt Sursee nachsehe, taucht das Wort «Wohnen» genau zwei Mal auf. Auch im Organigramm und der Gemeindestrategie ist wenig Konkretes zu finden. Letztere gleicht – ich sage es mit Absicht überspitzt – einer Sonntagsrede, die aus jeder Gemeinde stammen könnte. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass diese Moderation nicht primär die Aufgabe von politischen Akteuren sein soll. Das Bau- und Zonenreglement schafft den gesetzlichen Rahmen. Machen müssen es andere.
Wessen Aufgabe ist es denn dann?
Eines unabhängigen Gremiums beispielsweise. Das können breit abgestützte Organisationen wie Vereine oder Genossenschaften sein; ähnlich der bestehenden Wohnbau- oder der Energiegenossenschaften. Es braucht Leute, die vernetzt sind, Zusammenhänge herstellen, die Menschen zusammenbringen und Fragen stellen, die man im politischen Rahmen nicht stellen kann oder darf. Das kann auch eine kleine Gruppe auf Quartierebene sein, eine Quartierwohnbaugenossenschaft. Das Zauberwort heisst «anfangen». Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer könnten sich zusammenschliessen und gemeinsam gelungene Vorzeigebeispiele schaffen. Zudem würde eine solche Genossenschaft gemeinsame Investitionen ermöglichen. Dinge wie Heizsysteme oder Solarspeicher könnten zusammengelegt werden. Vielleicht zusammen mit der Energiegenossenschaft. Das würde auch wieder Platz schaffen. Mit auferlegten Regeln kommt man hier nicht weit. Die Innenentwicklung muss von unten nach oben stattfinden, also «bottom up», und auf freiwilliger Basis.
Bevor wir zu konkreten Lösungsansätzen kommen: Wo liegen denn für Sie die Ursachen der Wohnungsnot?
Die Anzahl der Einflüsse ist gross, doch die demographische Entwicklung macht mir am meisten Sorgen. Immer mehr Babyboomer, die Generation, zu der ich auch gehöre, wohnen in Wohnungen oder Häusern, wo sie bis vor Kurzem noch mit ihren Familien lebten. Während die ausgezogenen Kinder nun teuer für ihren Wohnraum zahlen, bleiben die Eltern im Eigenheim zurück. Die Anreize für einen Umzug sind klein. Auf weiter Flur sehe ich niemanden, der sich dieser Thematik annimmt, obschon sich diese Entwicklung noch weiter verschärfen wird.
Ich vermute, Sie haben bereits eine Lösung dafür gefunden.
Ja, etwas, das eigentlich bereits aus der Mode gekommen ist, sollte wieder die Regel werden: Das Generationenhaus. Dieses Modell hat sich nicht ohne Grund jahrelang bewährt. Nehmen wir ein Einfamilienhaus aus den 90er-Jahren. In der Regel sind die Parzellen gross. Mit den heutigen Möglichkeiten der Bau- und Zonenreglemente und des Holzbaus sind Aufstockungen gut realisierbar. In diesem Fall können die Nachkommen beispielsweise in diese neue kleinere Einheit einziehen. Wenn dann eine weitere Generation dazukommt, kann darüber nachgedacht werden, ob man einen Wechsel vollziehen möchte. Die neue Familie zieht nach unten, die Grosseltern nach oben. So würde der Platz effizient genutzt. Letztendlich ist das Generationenhaus keine technische Herausforderung, sondern eine Frage unserer Bereitschaft, soziale und familiäre Strukturen neu zu denken. Es erfordert ein Umdenken hin zu mehr Gemeinschaft, Teilen und gegenseitigem Respekt.
Dieses Prinzip könnte man aber auch ausweiten, nicht?
Ja, in meiner Wohngemeinde Buttisholz will man eine Überbauung errichten, die genau auf diesem Konzept basiert. Die Rede ist dort von Eigentum auf Zeit. Dies soll Wechsel innerhalb des Hauses erlauben. Wenn eine Mieterschaft weniger Platz benötigt, findet diese vielleicht Nachbarn, die zu einem solchen Wechsel bereit wären. Diese Flexibilität benötigt aber eine gute Beziehung unter den Mietparteien. Um ein familiäres Umfeld zu fördern, muss es Gemeinschaftsräume, wie etwa eine gemeinsame Grillstelle oder einen gemeinsamen Garten, geben. Solche Dinge umzusetzen, ist aber schwierig, weil erfolgreiche Beispiele fehlen. Hier könnten die Gemeinden ins Spiel kommen und eigene Pilotprojekte von lokalen Akteuren unterstützen. Denn dann, da bin ich mir sicher, würde sich die Entwicklung verselbstständigen.
Ihre Ausführungen über Gemeinschaftsräume entsprechen aber nicht dem, was man unter Innenverdichtung versteht.
Wer sagt denn, dass Innenverdichtung nur Verkleinerung bedeuten muss? Es bedeutet vor allem bessere Ausnützung. Die Qualität des Wohnens sollte nicht unter der Innenverdichtung leiden. Das würde ebendiese verhindern. Dem Gemeinschaftsleben muss Raum gegeben werden. Wenn das Nachbarschaftliche nicht klappt, wie soll denn das Vereinsleben und freiwillige Engagement noch funktionieren? Mit einer attraktiven Nachbarschaft mit gemeinsamen Aussenräumen werden beispielsweise auch Anreize für die vorhin angesprochenen Babyboomer geschaffen, das Eigenheim mit Garten zu verlassen.
Wenn der Wohnraum nicht verkleinert werden soll, müsste es aber angesichts des Bevölkerungswachstums langfristig in die Höhe gehen.
Ja, aber die Höhe allein wird es nicht richten. Es braucht kluge Wohn- und Quartierkonzepte für mehr Gemeinschaft.