Es ist entschieden: Der Eisvogel ist der Vogel des Jahres 2026. So haben über 18’000 Personen entschieden, die am Ranking von Birdlife Schweiz teilgenommen und abgestimmt haben. Zur Auswahl standen, laut der Medienmitteilung von Birdlife Schweiz, neben dem Sieger auch die Wasseramsel, die Gebirgsstelze, der Flussregenpfeifer und die Uferschwalbe. All diese Vogelarten haben eines gemeinsam: Ihre Lebensräume sind eng an fliessende Gewässer gekoppelt. Trotzdem braucht jede Vogelart ein ganz eigenes Umfeld. Der Eisvogel zum Beispiel benötigt stehende oder langsam fliessende Flüsse oder Bäche, deren Wasser klar und reich an Fischen ist. Wenn er seine Beute im Visier hat, stürzt er sich ins Wasser, um sie zu fangen. Im Gegensatz zum Eisvogel ist der Flussregenpfeifer auf Schotter- oder Sandbänken zu finden, wo er durch sein braun-weisses Gefieder fast nicht auffällt. Er trampelt gerne über den Grund, um Insekten aufzuscheuchen, die ihm als Nahrung dienen.
Auf Bedürfnisse aufmerksam machen
Vor einigen Jahrzehnten wurden grössere und kleinere Gewässer in der Schweiz als Schutz vor Hochwasser vermehrt kanalisiert, verbaut oder eingedolt. Dadurch sind sie als Lebensräume zum Teil verschwunden, weshalb auch der Vogel des Jahres 2026 heute stark gefährdet ist und auf der roten Liste steht. In der Schweiz leben zurzeit nur etwa 400 Eisvogel-Brutpaare. Zum Vergleich: Rotmilan-Paare gibt es ca. 3500, dieser Greifvogel ist nicht gefährdet. «Wir wollen mit der Wahl zum Vogel des Jahres genau auf solche Bedürfnisse in der Vogelwelt aufmerksam machen», sagt Stefan Bachmann, Mediensprecher Birdlife Schweiz.
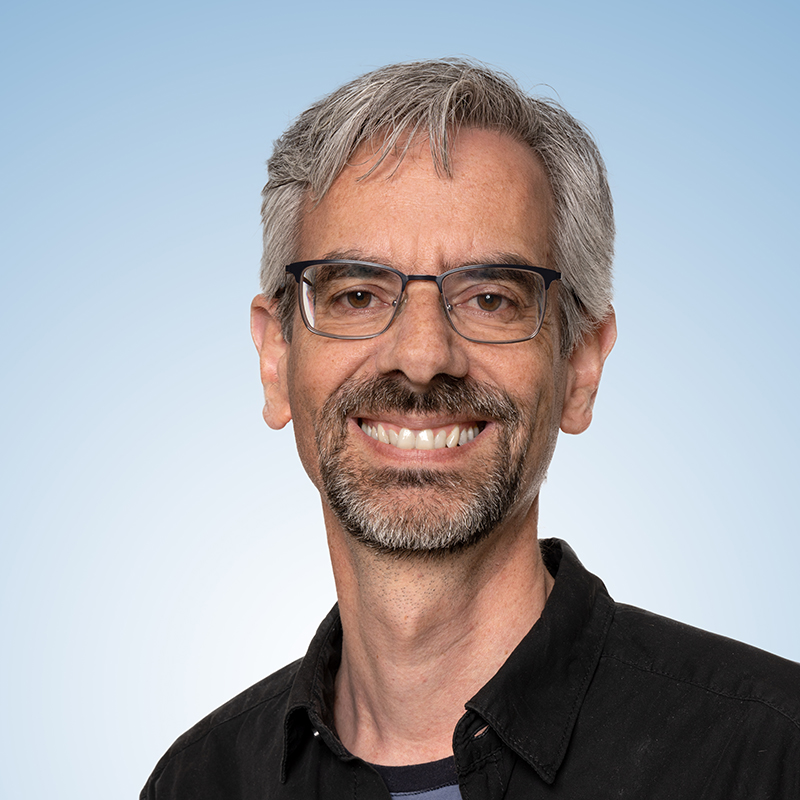
Stefan Bachmann.
Foto zVg
Seit 24 Jahren küren interessierte Schweizerinnen und Schweizer aus einer Auswahl von Vögeln mit ähnlichen Lebensräumen einen davon zum Erstplatzierten und damit zu deren Vertreter für das kommende Jahr. Im letzten Jahr gewann das Rotkehlchen und wurde damit zum gefiederten Botschafter für mehr Natur und Vielfalt im Siedlungsraum. Somit ist beim Eisvogel die Sache klar, er ist der «Botschafter für naturnahe Fliessgewässer».
Eisvogel in der Region, wo?
Wer den Eisvogel mit seinem blau-orange leuchtenden Gefieder beobachten möchte, kann ihn ganz in der Nähe sichten. Der Vogel des Jahres 2026 lebt in der Region am Mauensee, da dieser laut des Kantons Luzern ein fast vollständig natürliches Ufer aufweist. Dies ist aus einem Planungsbericht über die Revitalisierung von Seeufern im Kanton Luzern aus dem Jahr 2022 zu entnehmen.
Auch an der Sure kann der Eisvogel entdeckt werden, vorzugsweise dort, wo sich die Natur entfalten kann. Die besten Chancen, ihn zu sehen, sind in den kalten Jahreszeiten, denn im Sommer, während der Brutzeit, sucht sich der Eisvogel ein passenderes Habitat, um seinen Nachwuchs grosszuziehen.
Damit das Eisvogel-Paar brüten kann, braucht es eine senkrechte oder leicht überhängende Wand aus lehmiger Erde oder festem Sand. Diese entsteht am Ufer, wo es zum Beispiel durch Hochwasser abgebrochen ist. «Wo es keine solchen Abbrüche mehr gibt, kann der Mensch mit künstlichen Brutwänden Abhilfe schaffen. Der Eisvogel brütet manchmal aber auch in einem Wurzelstock», sagt Stefan Bachmann. «Sehr wichtig ist aber auch die Nahrungsbasis: kleine Fische. Und die findet er nur in naturnahen Flüssen mit guter Wasserqualität.» Pro Tag frisst der Eisvogel bis zu 35 Prozent seines eigenen Körpergewichts an Fischen, die meist vier bis sieben Zentimeter lang sind. Die Wasseramsel hingegen bevorzugt Wasserinsekten oder Larven, die in schnell fliessenden Gewässern vorkommen. Auch diese Vielfalt an Wasserlebewesen kann sich nur in sauberen und naturnahen Gewässern entfalten.
Sure und Sempachersee
Um für den Eisvogel – und seinen gefiederten Kumpanen – wieder mehr natürlichen Lebensraum zu schaffen, braucht es sogenannte Revitalisierungsprojekte. Diese haben zum Ziel, Gewässer möglichst naturnah aufzuwerten und ihnen wieder mehr Raum zuzugestehen. Dies verbessert direkt auch den Hochwasserschutz: «Wenn Gewässer wieder mehr Platz erhalten, kann Hochwasser viel besser aufgefangen werden», so Stefan Bachmann.
Ein regionales Beispiel dafür ist das bereits fertige Projekt an der Sure im Abschnitt vom Fischerhof bis zur Mündung des Hofbachs in Oberkirch. Auch in Triengen ist der Steibärebach aufgewertet worden und in Büron liegt nun ein Teil des Dorfbachs frei, welcher vorher geschlossen verlief. Weitere Projekte sind laut dem Kanton Luzern in Planung, dieser erarbeitet aktuell ein Massnahmenprogramm zum Schutz vor Naturgefahren und zur Revitalisierung der Gewässer. Wo nebst der Sure noch Potenzial besteht, ist am Sempachersee (diese Zeitung berichtete). Teile des Seeufers sollen für die Menschen sicherer und attraktiver gemacht und gleichzeitig für die Tierwelt diverser gestaltet werden. Ebenso ist geplant, diverse Mündungsbereiche von Dorfbächen wie zum Beispiel in Eich oder Schenkon umzugestalten. Das Ufer des Mauensees wird als stark naturnah eingestuft, weshalb dieses regionale Gewässer von der Planung ausgeschlossen ist.
Generationenprojekt von 80 Jahren
Bereits seit 2009 hat der Bund durch eine Änderung des Gewässerschutzgesetzes festgelegt, dass die Kantone Gewässer renaturieren müssen. Ursprung dafür war die Volksinitiative «Lebendiges Wasser», deren Gegenvorschlag dann durchkam. Vor zwei Jahren veröffentlichte der Bund Dokumente zur strategischen Planung für die Revitalisierung von Fliessgewässern. Daraus geht hervor, dass die Kantone bis Ende dieses Jahres ihre aktualisierte Planung zur Stellungnahme einzureichen und diese ein Jahr darauf zu verabschieden haben. Alle 20 Jahre muss die Planung aktualisiert werden, denn laut dem Bund handelt es sich beim Vorhaben, Fliessgewässer zu renaturieren, um ein Generationenprojekt mit einer Zeitspanne von 80 Jahren. «Für die Natur sind diese Gewässerrevitalisierungen sehr wichtig», so Stefan Bachmann. «Die ursprünglichen Lebensräume können zwar nicht mehr hergestellt werden, aber wenigstens ein Teil davon.»







