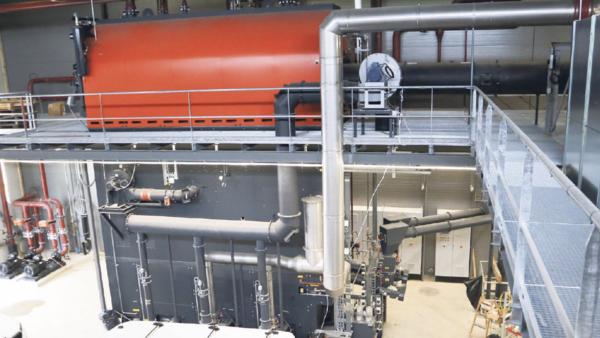Wenn sich im September die Bienensaison dem Ende zuneigt, laden die Luzerner Imkerinnen und Imker in die Festhalle Sempach. Die Luzerner Bienentage ziehen seit vielen Jahren Fachleute und Interessierte aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland an. Aus dem ursprünglichen «Luzerner Imkertag» ist nun das «Bienenforum» geworden. Der neue Name bringt frischen Wind und betont, worum es den Organisatorinnen und Organisatoren geht: Austausch, Weiterentwicklung, Lernen und Erleben rund um die Bienen – offen, inspirierend, praxisnah.
Bienen wollen hoch hinaus
Die Premiere des «Bienenforums» strahlte über die Kantonsgrenzen hinaus, auch wenn der Besucherandrang etwas kleiner war als in früheren Jahren. Nichtsdestotrotz überzeugte der Anlass inhaltlich: Fachreferate vermittelten wertvolles Wissen zu den vielfältigen Herausforderungen, die der Honigbiene gegenüberstehen.
So sprach unter anderem Bigna Zellweger, Zoologin und Imkerin aus Tenna in Graubünden, über unterschiedliche Faktoren, die zur Immunität von Bienenvölkern beitragen. «Wenn es nach den Bienen ginge, würden sie am liebsten auf acht Metern Höhe leben», erklärt sie. Zellweger betreut selbst ein Zeidlerprojekt auf 1650 Metern über Meer. Die Zeidlerei ist eine Form der Imkerei, bei der Honig aus Baumhöhlen gewonnen wird. Die Tradition ist Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend aus Westeuropa verschwunden, lebt aber in Teilen Osteuropas weiter.
Vielseitige Schutzmechanismen
Zellweger verstand es, wissenschaftliche Fakten verständlich aufzubereiten. Sie zeigte auf, wie Honigbienen mit unterschiedlichen Strategien ihre Gesundheit schützen: durch den Chitinpanzer, der den Körper und die Organe schützt, durch gegenseitiges Putzen und Pflegen («grooming») oder durch die Einhaltung der Sauberkeit im Stock. Dazu gehört auch, dass alte oder kranke Tiere ihr Zuhause freiwillig verlassen, um ausserhalb des Bienenstocks zu verenden. Auch gegenüber Feinden und Eindringlingen wehren sich Honigbienen durch unterschiedliche Abwehrmechanismen, wie die Temperaturregulation oder das Mumifizieren. «Besonders spannend ist, dass Bienen ihr eigenes Gift verwenden, um sich gegenseitig zu schützen», erzählt Bigna Zellweger. Dafür reiben sich die Bienen gegenseitig mit ihrem Gift ein, was laut einer Studie antibakteriell wirkt.
Honig, Bienenbrot und Propolis
Auch die Ernährung spielt eine zentrale Rolle. Um die Gesundheit im Volk aufrechtzuerhalten, sind Honigbienen auf zuverlässige Pollen- und Nektarquellen angewiesen. «Blüten von Brombeersträuchern sind besonders Proteinreich», so Zellweger. Aus den gesammelten Produkten produzieren die Bienen Honig, Geleé Royale, Bienenbrot (fermentierte Blütenpollen) oder Propolis. Letzeres hat eine vielseitige, antibakterielle Wirkung, fördert das Immunsystem und schützt den Bienenstock gar bei Waldbränden.
Was kann man tun?
«Die Biodiversität fördert nachweislich die Bienengesundheit», hält Zellweger fest. Vielfältige Pflanzen, weniger Pestizide, das Vermeiden von Monokulturen und Aufklärung im Umfeld seien entscheidend. Auch Blühstreifen an Feld- und Wegrändern leisten viel. «Ich plädiere dafür, dass dort, wo es vertretbar ist, auch mal ein toter Baum stehen gelassen wird», so Zellweger, denn diese dienen wildlebenden Bienen als wertvoller Lebensraum.
Bienenbrunch begeisterte
Auch am Sonntag standen im Rahmen des «Bienenzaubers» die positiven Effekte von Bienenprodukten im Mittelpunkt. Rund 650 Besucherinnen und Besucher genossen den Imkerbrunch, die Ausstellung und die Marktstände, die Kurzvorträge zur Honigqualität, Bienenprodukte und der Asiatischen Hornisse, ein Kinderprogramm sowie die Sonderschau «Bestäubung und Klimaschutz». «Wir sind mit dem Anlass sehr zufrieden», lautet das Fazit der Organisatorinnen und Organisatoren.
Die nächsten Luzerner Bienentage finden am 12. und 13. September 2026 statt.
Asiatische Hornisse erkennen und melden
Mithelfen
Im Rahemen der Luzerner Bienentage gaben Fachpersonen der Basler Koordinationsstelle für die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse Auskunft. Das Thema ist hochaktuell, was sich am grossen Andrang Interessierter zeigte.
Die Asiatische Hornisse ist eine invasive, gebietsfremde Hornisse, die sich sehr schnell in der Schweiz verbreitet. Da sie zur Fütterung ihrer Brut viel Nahrung benötigt, bedroht sie einheimische Insektenarten massiv. Zudem kann sie durch Frass an Früchten Schäden im Obst- und Weinbau verursachen.
Im Gegenzug zur Europäischen Hornisse ist die Asiatische Hornisse kleiner und hat einen dunkleren Körper. Ihre Primärnester (klein und kugelförmig, im Frühling) befinden sich unter Vordächern, an Garagen und Unterständen oder in Hecken und Büschen. Im Sommer und Herbst siedeln sie in Sekundärnester um, die bis zu 80 cm gross werden und in Baumkronen im Siedlungsraum, im Wald oder selten an Gebäuden vorkommen.
Bei Sichtung eines verdächtigen Nests oder einer Asiatischen Hornisse ist Folgendes zu beachten:
- Abstand halten, denn Hornissen verteidigen das Nest aggressiv
- Foto oder Video machen
- Verdächtige Hornissen und Nester auf der nationalen Meldeplattform www.asiatischehornisse.ch melden. RED